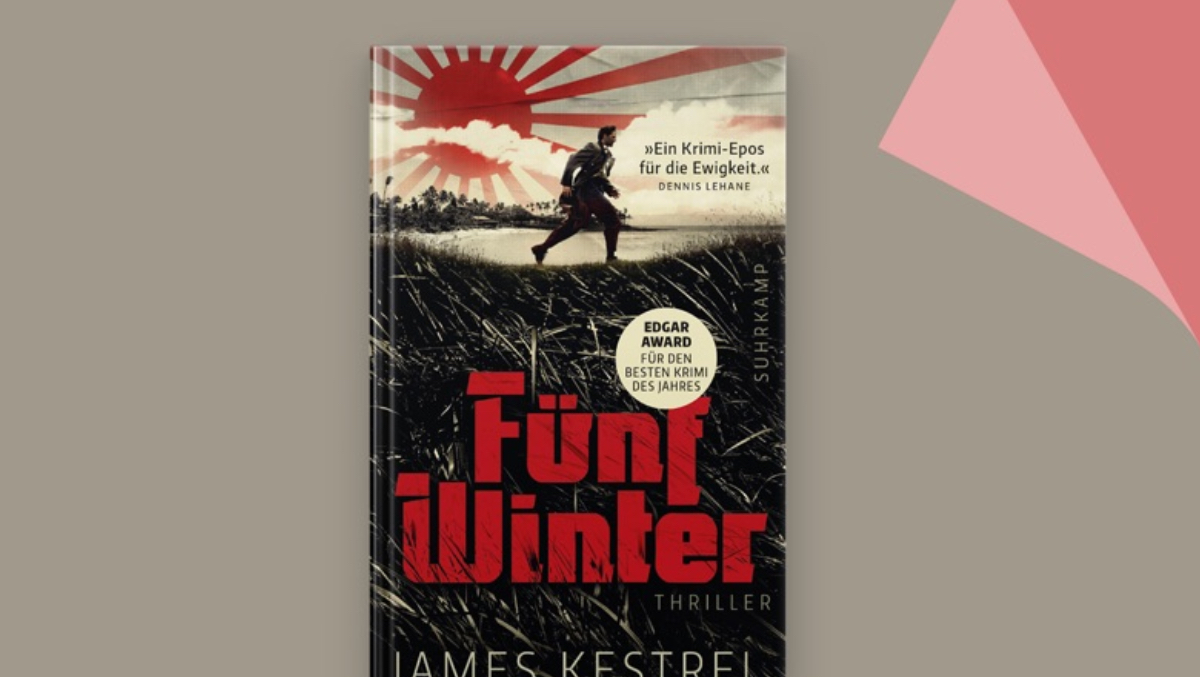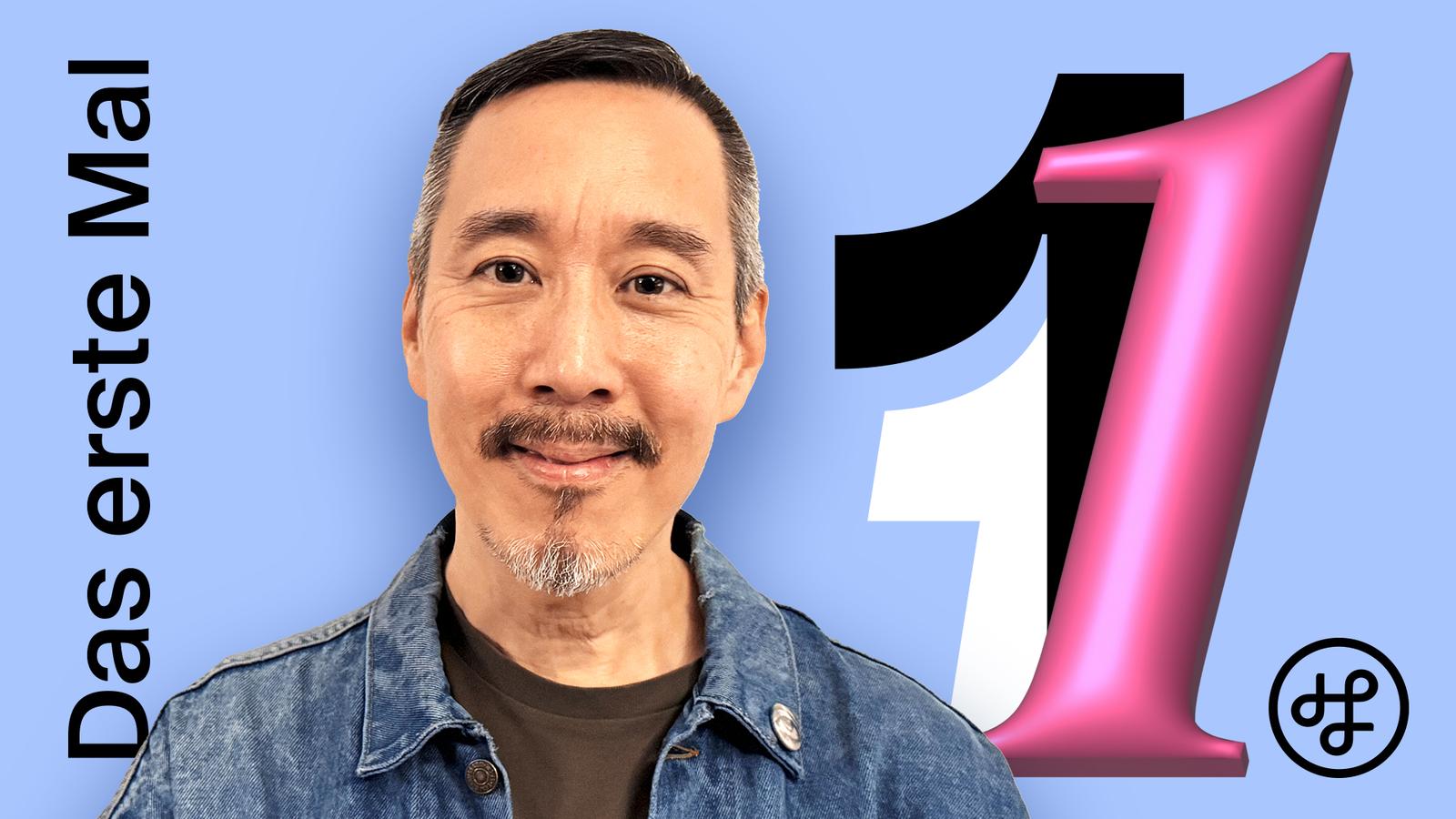Experten-Interview : Kann Meditation schaden?
Beim Meditieren gerät man in einen Zustand tiefer Entspannung. Doch an der Methode gibt es auch Kritik. Psychologe Dr. Boris Bornemann nennt Warnsignale – und erklärt, wie Achtsamkeit gelingt

Beim Meditieren gerät man in einen Zustand tiefer Entspannung. Doch an der Methode gibt es auch Kritik. Psychologe Dr. Boris Bornemann nennt Warnsignale – und erklärt, wie Achtsamkeit gelingt
BRIGITTE: Vor einigen Monaten titelte ein Nachrichtenmagazin: "Die dunkle Seite des Achtsamkeitstrends". Es ging um die Risiken und Nebenwirkungen von Meditation und Yoga. Es wurde von Panikattacken, Selbstbezogenheit und Traumata berichtet. Was ist da dran?
Dr. Boris Bornemann: Grundsätzlich kann alles, was wirkt, unerwünschte Nebenwirkungen haben. Problematisch finde ich es, wenn einseitig vor allem die Schattenseiten von Meditation betont werden. Dabei gibt es viele Studien, die positive Effekte klar belegen.
Welche zum Beispiel?
Eine australische Meta-Analyse hat gezeigt, dass sich Menschen, die in Achtsamkeit geschult sind, prosozialer verhalten – also freundlicher, empathischer, unterstützender und eher am Wohlergehen anderer orientiert. Die vielen tausend Studien, die bislang zu Meditation erschienen sind, legen nahe, dass es die psychische Gesundheit in der Regel verbessert, Ängstlichkeit, Depressionen und Stress reduziert und hilft, besser zu schlafen und zufriedener und gesünder zu leben. Im Großen und Ganzen sind die Effekte von Achtsamkeit und Meditation also deutlich positiv.
Und im Kleinen?
Eine Überblicksarbeit hat 2020 gezeigt, dass etwa ein Drittel der Menschen, die schon mal meditiert haben, unerwünschte Effekte erlebt haben. Häufig sind dabei körperliche Unruhe, Schläfrigkeit oder Frust über das Abschweifen und die Konfrontation mit unangenehmen Gefühlen. Bei höheren Dosen der Meditation, etwa ab 30 Minuten, ändert sich der Schlaf – manche Menschen wachen nachts häufiger auf. Eher selten kommen auch traumatische Episoden wieder an die Oberfläche. Es kann Panikattacken oder auch dissoziative Zustände geben – also das Gefühl, neben sich zu stehen oder vom eigenen Körper getrennt zu sein.
Das klingt beängstigend. Wie riskant ist das?
Na ja, wer sich selbst erforscht oder eine Psychotherapie beginnt, wird über kurz oder lang auch mit unangenehmen Gefühlen konfrontiert. Das gehört zum Heilungsprozess dazu. Ein Ziel von Meditation ist es ja, innerlich lebendig und frei zu werden. Das bedeutet unter anderem: Wir lassen unsere Gefühle zu, statt sie zu verdrängen. Dadurch werden wir sensibler, was schön ist, aber auch überfordern kann.
Manchmal haben wir Probleme, die Reize zu filtern oder einzuordnen. Das kann desorientieren und ängstigen. Traumatische Erfahrungen können wieder an die Oberfläche kommen. Im Idealfall schaffen wir durch die Meditationspraxis ein wohlwollendes inneres Klima und sind freundlich und fürsorglich mit uns. Dann können die belastenden Erfahrungen gut integriert werden. Dies kann dann heilsam wirken. Aber in einigen Fällen sind die Zustände auch so belastend, dass therapeutische Begleitung erforderlich wird.
Gibt es grundsätzlich Leute, die besser nicht meditieren sollten?
Menschen, die psychisch besonders belastet sind, berichten häufiger über unerwünschte Nebenwirkungen von Meditation – zum Beispiel Menschen, die eine schwere Kindheit hatten, oder die mit Depressionen oder psychotischen Symptomen zu tun haben. Hier rate ich, sich therapeutisch dabei begleiten zu lassen. Und sich selber immer wieder zu beobachten und zu fragen: Tut es mir gut?
Was, wenn ich dabei ängstlich oder panisch werde?
Für viele Menschen ist es günstig, mit der Aufmerksamkeit zum Körper kommen. Der Körper ist immer im Hier und Jetzt. Darüber kommen wir zurück in die Ebene des Spürens. Das beruhigt. Für viele Menschen ist es besonders erdend, die Aufmerksamkeit nach unten in den Körper zu schicken, also zum Beispiel zum Bauch oder in die Füße. Wir brauchen etwas Geduld. Wenn wir eine Weile mit der Aufmerksamkeit dort verweilen, legt sich die Angst oft. Auch tiefe, langsame Atemzüge helfen, uns zu beruhigen. Wenn sich das aber nicht gut anfühlt: Lieber die Meditation abbrechen, aufstehen, ein paar Schritte gehen. Raus in die Natur. Eine Freundin oder einen Freund anrufen. Wichtig ist, dass wir nicht in den unangenehmen Gefühlen schmoren, sondern uns fragen: Was könnte mir jetzt guttun?
infokasten-boris-bonemann-ballon-app
Manchmal kommen beim Meditieren ja auch negative Gedanken auf. Wie geht man damit um?
Als Faustregel können wir sagen: Meditieren sollte zu 70 Prozent angenehm sein. Wenn man spürt, dass einem das Meditieren gerade nicht guttut, kann es sinnvoll sein, abzubrechen. Oder vielleicht zu einer anderen Form wie der Freundlichkeitsmeditation zu wechseln, wo man sich auf liebevolle Güte oder Dankbarkeit konzen-triert. Bei negativen Gedanken kann man sich auch selbst beschreiben, was man gerade denkt und fühlt: Mich beschäftigt gerade, dass… So schafft man Abstand und identifiziert sich nicht mit seinen Gedanken. Man macht sich klar: Gedanken sind Ereignisse in mir. Ich kann sie betrachten und hinterfragen, und manchmal auch einfach vorbeiziehen lassen. Ich muss nicht alles glauben, was ich denke.
Oft kommt auch der Einwand: Ich kann nicht meditieren, weil ich so viele Gedanken habe.
Ein häufiger Irrtum, denn Gedankenfreiheit ist ja gar nicht das Ziel von Meditation. Es geht darum, sich bewusst zu sein, was in einem geschieht – das kann auch Denken sein. Mir passiert das zum Beispiel, wenn viel bei mir los ist, wenn eine wichtige Entscheidung ansteht. Und das ist okay. Ich kann mir das bewusst machen und dann zu meinem Atem oder meinem Körper zurückkommen. Je öfter ich das übe, desto einfacher wird es, sich von seinen Gedanken wieder zu lösen, sie nur wahrzunehmen und wertfrei zu betrachten.
Was sollte man noch beim Meditieren beachten?
Ganz wichtig ist es, fürsorglich und mitfühlend mit sich umzugehen und mit kleinen Dosen zu beginnen, vielleicht mit ein paar Minuten am Tag und angeleitet. Grundsätzlich sollte man sich fragen, was einem persönlich hilft. Und das ist für verschiedene Leute sehr unterschiedlich. Ich zum Beispiel meditiere am liebsten allein in Stille, weil dann nur die eigenen inneren Prozesse da sind. Wenn man sehr kritisch mit sich ist, kann es auch schön sein, einer wohlwollenden Stimme zuzuhören. Was sehr hilft, ist, sich eine Umgebung aufzubauen, in der man sich wohlfühlt, sodass man richtig Lust aufs Meditieren bekommt. Eine Körperhaltung zu finden, die angenehm ist – man muss nicht immer aufrecht sitzen, liegen ist auch okay oder langsames Gehen. Und eine Dauer, die passt, und eine Technik, die einem gefällt.
Ihr Fazit lautet also: Wir sollten es unbedingt ausprobieren?
Ich sehe es so: Mit dem Meditieren ist es ähnlich wie mit dem Sport. Dort gibt es auch Verletzungen oder sogar dauerhafte Leiden. Das sind aber keine Gründe, Sport zu verdammen, denn richtig ausgeführt hält er uns gesund und erhöht die Lebensqualität. Zusammenfassend kann man sagen: Es ist schädlicher für unsere mentale Gesundheit, nicht zu meditieren als zu meditieren. Zugleich ist es gut, über mögliche Nebenwirkungen Bescheid zu wissen. Gut auf sich zu achten und nur Wege zu gehen, die sich liebevoll und nährend anfühlen, dem inneren Kompass zu vertrauen. Und wenn man den Eindruck hat, etwas tut nicht gut, dann spricht man am besten mit Menschen darüber – einem qualifizierten Meditationslehrenden, Freund:innen oder therapeutisch geschulten Menschen.












![Microsoft 365: Outlook Fehler [58tm1]](https://i.postimg.cc/0QN96KjY/image.png)