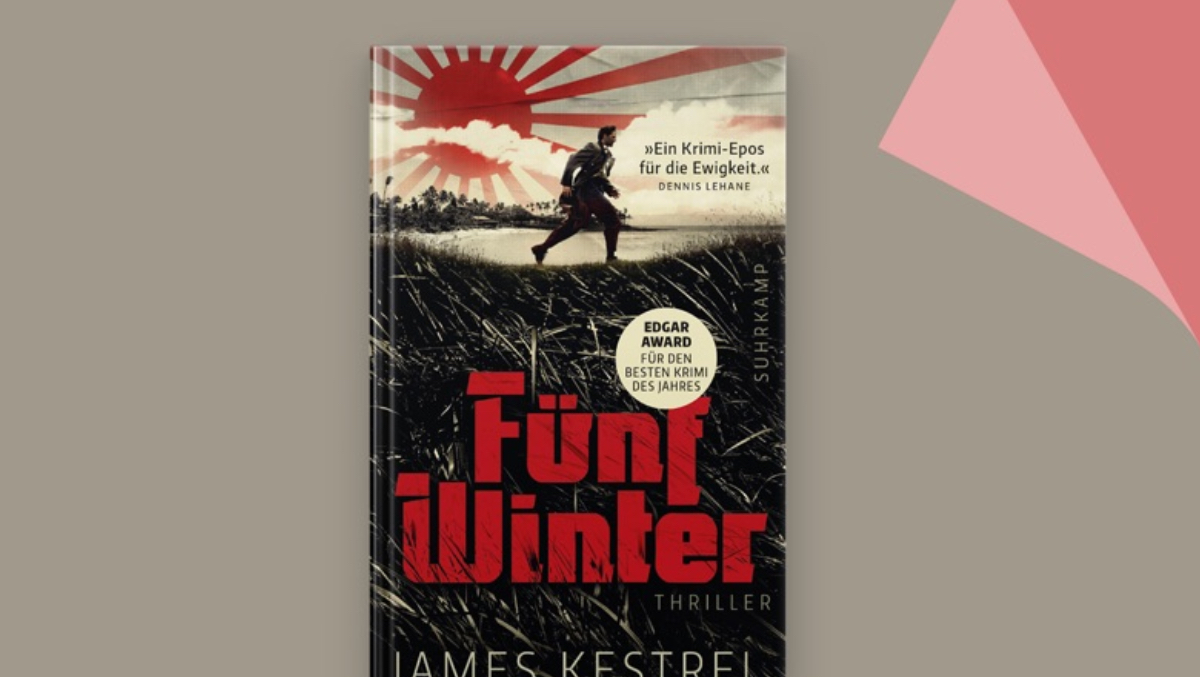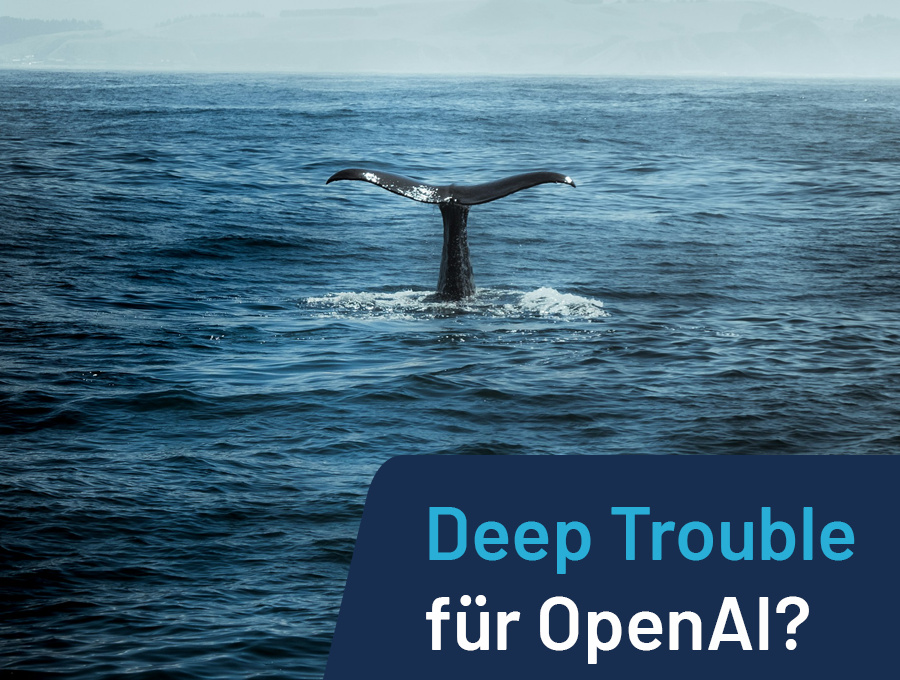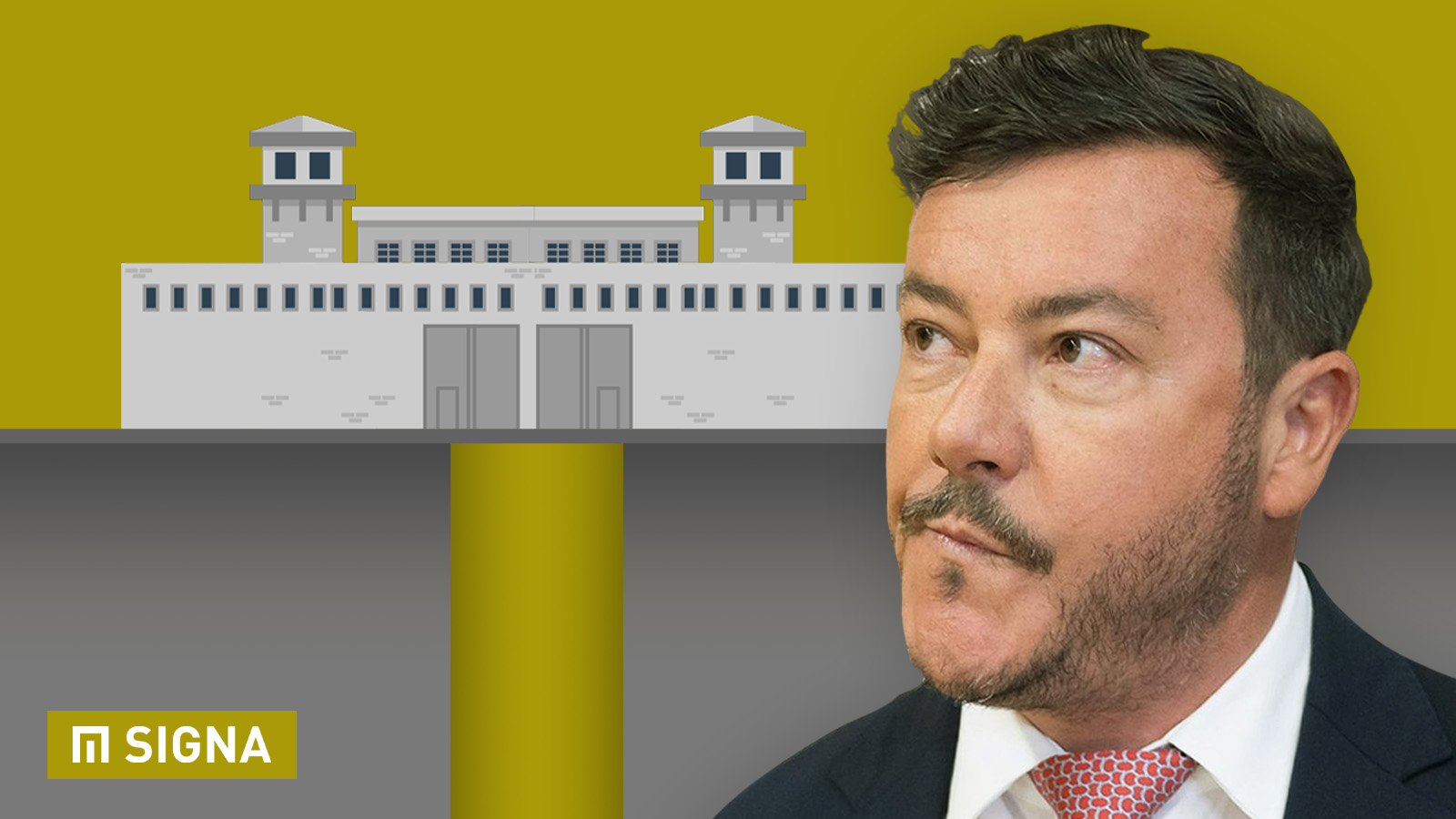Peter Knuth: Die deutsche Solarindustrie steckt zwischen Boom und Absturz
Trotz eines Rekordzubaus im vergangenen Jahr steht die PV-Branche vor großen Problemen. Das Dilemma ist hausgemacht – und wird durch politische Planlosigkeit verstärkt, meint Peter Knuth

Trotz eines Rekordzubaus im vergangenen Jahr steht die PV-Branche vor großen Problemen. Das Dilemma ist hausgemacht – und wird durch politische Planlosigkeit verstärkt, meint Peter Knuth
Die deutsche Solarbranche gleicht einem Schauplatz für ökonomische Widersprüche: Während Großanlagenprojektierer Rekordumsätze feiern, kämpfen Handwerksbetriebe, die private Photovoltaikanlagen installieren, ums Überleben. Der Sektor, einst gefeiert als Hoffnungsträger der Energiewende, wirkt zunehmend gespalten. Dabei ist die Ursache dieses Dilemmas ebenso hausgemacht wie politisch verstärkt.
In den Jahren 2020 bis 2022 schien die Sonne nicht nur sprichwörtlich auf die Solarbranche. Pandemiebedingte Reiseeinschränkungen, steigende Energiekosten durch den Ukrainekrieg und eine kollektive Angst vor Blackouts führten zu einem regelrechten Ansturm auf private PV-Anlagen. Allein im Frühjahr 2022 war die Nachfrage zehnmal so hoch wie im Vorjahr. Betriebe konnten kaum mit den Bestellungen Schritt halten, während Materialknappheit und überlastete Montagekapazitäten die Preise explodieren ließen – um bis zu 30 Prozent innerhalb weniger Monate.
Doch der Boom hatte eine Schattenseite: Der drastische Anstieg der Energiepreise lockte auch viele unqualifizierte Anbieter an. Dank einer fehlenden Meisterpflicht bei der Installation von Photovoltaikanlagen konnten Laien schnell in den Markt einsteigen. Die Folge war ein Qualitätseinbruch – auf Kosten der etablierten Fachbetriebe, die nun mit sinkender Nachfrage und wachsendem Wettbewerb kämpfen.
Als die Nachfrage 2023 rapide abflaute, stiegen die Probleme. Chinesische Hersteller überschwemmten den europäischen Markt mit subventionierten Solarmodulen und Speichersystemen. Deutsche Hersteller, ohnehin unter schärferen Regulierungen und höheren Produktionskosten leidend, konnten nicht mithalten. Die FDP verschärfte die Situation, indem sie im März 2024 den Resilienzbonus blockierte – ein Instrument, das die heimische Produktion hätte stärken können.
Das Resultat: Die letzten deutschen Modulhersteller schlossen ihre Produktionsstätten, und mit ihnen verschwand ein Teil der Wertschöpfungskette. Doch auch die chinesischen Produzenten spüren nun die Auswirkungen eines übersättigten Marktes. Lager in europäischen Häfen quillen über, und ein ruinöser Preiskampf hat begonnen, der auch für viele asiatische Unternehmen das Ende bedeuten könnte.
Solarbranche: Wer profitiert vom Preisverfall
Die Gewinner des Chaos: Freiflächenanlagen
Ironischerweise gibt es auch Profiteure dieser Krise: Großanlagenprojektierer. Freiflächenanlagen können dank billiger chinesischer Module und ausländischer Montagetrupps zu geringen Kosten realisiert werden. Doch selbst hier drohen Probleme. Der Anschluss solcher Anlagen ans Stromnetz wird zunehmend schwieriger, und die Ankündigung der chinesischen Regierung, Exportsteuerrabatte zu kürzen, könnte die Margen empfindlich drücken. Zudem stellt sich die Frage, ob es nachhaltig ist, Freiflächen für PV-Anlagen zu nutzen, während Städte und Industriegebiete weiterhin ungenutzte Dachflächen bieten.
Der politische Umgang mit der Solarbranche gleicht einem Lehrbuch für Managementfehler. Die Ampelregierung verschärfte die Unsicherheit mit widersprüchlichen Maßnahmen. Nach endlosen Diskussionen um den Resilienzbonus folgte die überraschende Abschaffung der E-Auto-Förderung. Das Heizungsgesetz wurde so schlecht kommuniziert, dass es mehr Verwirrung und Angst stiftete, als Klarheit schuf. Zuletzt sorgten Überlegungen zur Abschaffung der Einspeisevergütung und möglichen Strafzahlungen für eingespeisten Strom während Zeiten hoher Netzbelastungen für weitere Verunsicherung.
All dies trägt dazu bei, dass Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen das Vertrauen in eine konsistente Energiepolitik verlieren. Dabei wird eine stabile und dezentrale Energieversorgung dringender benötigt denn je.
Solar-Unternehmen klagen über Auftragsverluste
Die Elektrifizierung von Mobilität und Heizungssystemen schreitet voran. Doch während das E-Auto und die Wärmepumpe im politischen Fokus stehen, bleibt der notwendige Ausbau der Stromnetze vielfach auf der Strecke. In vielen Stadtbezirken führen mangelnde Kapazitäten bereits jetzt zu Problemen, wenn abends Tausende E-Autos gleichzeitig geladen werden. Hier helfen weder Atomkraftwerke noch symbolische Subventionen für neue Technologien. Es braucht eine umfassende Strategie, die Netzstabilität mit dezentraler Energieproduktion verbindet.
Die Branche braucht keine Almosen – sondern Stabilität
Die Solarbranche hat längst bewiesen, dass sie auch ohne Subventionen wettbewerbsfähig ist. Was sie jedoch nicht braucht, sind endlose politische Diskussionen, die Investitionen und Innovationen blockieren. Die nächste Bundesregierung muss die Weichen für klare und langfristige Rahmenbedingungen stellen. Dabei sollten drei Punkte im Fokus stehen:
- Förderung von heimischen Herstellern: Made in Germany steht noch immer für Qualität. Ein gezieltes Schutzprogramm für inländische Produktionen könnte Arbeitsplätze sichern und strategische Abhängigkeiten verringern.
- Qualität durch Handwerksordnung: Eine Meisterpflicht für die Installation von PV-Anlagen würde nicht nur die Qualität steigern, sondern auch dem Ruf der Branche guttun.
- Netzausbau priorisieren: Die Elektrifizierung der Gesellschaft wird ohne leistungsfähige Stromnetze scheitern. Ein massiver Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur sind unerlässlich.
Ein Weckruf für die Politik
Die Solarbranche hat das Potenzial, eine Schlüsselrolle in der Energiewende zu spielen. Doch anstatt von einem Boom zum nächsten zu stolpern, braucht es eine klare und durchdachte Strategie. Die Bundestagswahl 2025 könnte ein Wendepunkt sein. Ob die Branche danach aufblüht oder weiter in der Zerrissenheit verharrt, liegt in den Händen der politischen Entscheidungsträger.
Eines ist sicher: Ohne eine funktionierende Solarbranche wird Deutschland die Klimaziele verfehlen – und mit ihnen den Anspruch, ein Vorreiter in der globalen Energiewende zu sein.