Mali’yi Bulun – Finding Mali
Wilde Partys, Punks und Straßenschlachten: Das war meine Zeit in Istanbul – auch dank meines damaligen Mitbewohners. Elf Jahre später mache ich mich auf die Suche nach ihm. The post Mali’yi Bulun – Finding Mali appeared first on VICE.

Das letzte Mal sah ich Mali auf einer der Barrikaden. In seinem abgewetzten Morgenmantel, umringt von seinen Jungs und umweht von Tränengasschwaden wirkte er wie ein General in einem dystopischen Steampunk-Comic. Durch seine große goldumfasste Brille inspizierte er misstrauisch die Szene um sich herum: die aufgetürmten Müllcontainer, die Flaggen, die Hunderten maskierten Demonstranten, die sich mit Sprechchören, Getrommel und Pfiffen in Stimmung brachten für den nächsten Angriff. Ich weiß noch, dass ich beeindruckt war: Diese Bewegung hatte es geschafft, sogar Mali auf die Straße zu bringen. Ich freute mich irgendwie, ihn da zu sehen. Aber ich ging trotzdem nicht hin, um mit ihm zu sprechen.
Das muss im Juni 2013 gewesen sein, auf dem Höhepunkt der Gezi-Proteste in Istanbul – den ersten und zugleich letzten ernstzunehmenden Protesten gegen die Regierung Erdoğans. Zwei Monate später verließ ich die Türkei, um für VICE in Berlin zu arbeiten. Wegen meiner Artikel über den Aufstand hatte man mir dort einen Job angeboten. Ich blieb für etwas mehr als zehn Jahre, bis der Laden dieses Jahr unrühmlich in sich zusammenfiel. Man kann also durchaus behaupten, dass Gezi mein Leben verändert hat. Aber trotzdem war dieser Aufstand nur eins der Phänomene, die meine Zeit in Istanbul geprägt haben. Das andere war Mali.

Mali war mein Mitbewohner in der Wohnung, in der ich acht meiner zwölf Monate in Istanbul verbrachte. Oder genauer: Er war der Hauptmieter und Hauptbewohner, und ich war einer der vielen Ausländer, die in schneller Abfolge durch die anderen beiden Zimmer rotierten, um mit der Miete ihren eigentlichen Zweck zu finanzieren. Denn unsere Wohnung bildete den Mittelpunkt – und inoffiziellen Club – der Szene, deren unumstrittener König Mali war: der Untergrund, die schwulen Punks von Beyoğlu, die auf bizarre Kostüme standen und auf Unmengen in der Nachbarschaft zusammengepanschtes Ecstasy, auf dreckige Musik und Partys, auf denen man nächtelang kreischend herumspringt. Das fand ich allerdings erst heraus, nachdem ich eingezogen war.
Ich kam im Sommer 2012 nach Istanbul mit einem abgeschlossenen Master in Byzantinistik und der vagen Idee, einen Job bei irgendeinem Start-up zu finden. Zuerst kam ich über Kontakte bei einem netten Uni-Dozenten in Ortaköy unter, aber das liegt recht weit außerhalb des Zentrums und ich wollte dringend rein in die Stadt. Eines Tages sah ich auf Craigslist die Annonce. Ich erinnere mich noch an sie, weil der Text so wahnsinnig fröhlich war. “Experience the amazing Çukurcuma spirit!” oder so ähnlich lautete die Überschrift, und in diesem Stil ging es flüssig und blumig weiter. Ich wusste nicht viel über Çukurcuma, aber das Viertel lag direkt neben Cihangir, dem Hipster-Herz von Istanbul. Deshalb bewarb ich mich. Recht bald antwortete mir jemand in auffallend weniger flockigem, eher gebrochenem Englisch. Ich könne am Samstag vorbeikommen, müsse mich dann aber schnell entscheiden. Das war mein erster Kontakt mit Mali. Später erfuhr ich, dass eine Freundin die Annonce für ihn geschrieben und sich einen Spaß daraus gemacht hatte, die Wohnung besonders blumig und hippiemäßig zu beschreiben.
Der Typ, der mir die Tür aufmachte, hatte nichts von einem Hippie. Vor mir stand eine Art türkischer David Bowie in einem alten Morgenmantel, komplett mit lackierten Fingernägeln und Eyeliner, der mich durch seine goldene Oversize-Brille alles andere als beeindruckt musterte. “Oh, another German”, sind die ersten Worte, an die ich mich aus Malis Mund erinnere. Davon abgesehen redete er nicht mehr viel mit mir an diesem ersten Tag.
Als ich die Wohnung sah, entschied ich trotzdem sofort, dort einzuziehen. Erstens gefiel mir die Einrichtung: Mali hatte die Altbauwohnung ausschließlich mit Möbeln von der Straße ausgestattet und die Wände mit allen möglichen Bildern vollgehängt. Dazwischen hatte jemand umgedrehte schwarze Kreuze direkt auf die Wand gepinselt. Vor allem mein Zimmer war perfekt. Es war schmal und enthielt nicht viel mehr als ein durchgelegenes, nicht sehr sauber wirkendes Bett, aber es hatte am Ende eine Tür zum Balkon. Von dort aus konnte ich über das Goldene Horn bis auf die Hagia Sophia blicken. Was kümmerte mich da der schlecht gelaunte Typ? Ich zog ein.


Es dauerte nicht lange, bis ich merkte, dass ich in eine etwas andere Wohnung gestolpert war. Wenn ich jemandem erklären will, wie es war, dort mit Mali zu leben, dann erzähle ich meistens folgende Geschichten:
- Jeden Freitag versammelten sich 20 bis 50 Leute bei uns, viele davon in extravaganten Lumpen-Kostümen. Sie verschlangen Ecstasy-Tabletten, die irgendwie handgemacht aussahen, und tanzten durch die Wohnung. Mali war so etwas wie ihr Zeremonienmeister, der die Festivitäten von seinem Sofa aus dirigierte und Musik auflegte. Das war beeindruckend – außer man hatte am nächsten Tag etwas zu tun und wollte schlafen. Ich machte aber nicht oft den Fehler, Mali zu bitten, die Musik runterzudrehen. Das hatte nämlich zur Folge, dass er mir zuliebe die ganze Nacht über immer wieder Rebecca Blacks grauenhaftes “Friday” auflegte und sich dabei großartig amüsierte.
- Ich erfuhr später vom dritten Mitbewohner, Julian aus Deutschland, warum Mali bei meiner Ankunft so schlecht auf Deutsche zu sprechen war: Bei der Party am Freitag davor hatte es einen Riesenkrach gegeben, weil Julian einen gutaussehenden blonden Freund zu Besuch hatte, mit dem mehrere von Malis Freunden etwas haben wollten. Es sind dann wohl auch ein paar Sachen passiert, mit denen der blonde Deutsche vor seiner Istanbul-Reise niemals gerechnet hätte. Am Ende waren jedenfalls alle sauer auf ihn.
- Keine Tür in unserer Wohnung hatte eine Klinke, auch die zur Dusche und zum Klo nicht. Auf den Fliesen in der Dusche lag immerhin ein großer Feldstein, mit dem man die Tür von innen notdürftig zuklemmen konnte. Als mich meine damalige Freundin besuchen wollte, kaufte ich ein paar Türklinken und schraubte sie an. Als Mali das sah, runzelte er die Stirn, rief “this is not the style of this place!” und wollte, dass ich sie wieder abschraube. Ich konnte dann mit ihm aushandeln, dass ich sie erst nach der Abreise meiner Freundin wieder abbaue.
- Erst später verstand ich, warum Mali immer ein Halstuch trug. Kurz vor meinem Einzug hatte sich ein guter Freund von ihm auf einer Party so über Mali geärgert, dass er ihm mit einem Glas ins Gesicht schlug. Das Glas zersprang und schlitzte Mali den Hals über mehrere Zentimeter auf. Er verlor sehr viel Blut, seine Freunde konnten ihn gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus bringen. Dort nähte man ihn notdürftig zusammen und setzte ihn wieder auf die Straße, weil er keine Krankenversicherung hatte. Danach verbrachte Mali Tage in seinem Bett und kämpfte um sein Leben, während seine engsten Freunde um ihn herum Wache hielten.
- Bei einer Party war ein türkisches Pärchen zu Gast, der Typ war sehr unangenehm und hibbelig. Er hatte offenbar zu viel Speed genommen. Ich weiß noch, dass er mir erzählte, er sei Kapitän und steuere “die ganz großen Schiffe”, “the big fuckers!”, dabei zitterten seine Augenlider. Irgendwann ging er ins Nebenzimmer, aus dem dann kurz darauf Schreie und Gepolter drangen. Der Kapitän hatte seine Freundin im Gespräch mit einem fremden Mann gesehen und ihr ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen. Es gab ein riesiges Geschrei, Malis Freunde stürzten sich auf den Durchgedrehten, die Freundin rannte weinend aus der Wohnung. Nach einem kurzen Sicherheitsabstand warfen wir dann auch ihn raus. Eine halbe Stunde später stand er plötzlich wieder vor der Tür, weinend. Seine Freundin habe ihn ausgesperrt, schluchzte er, und er wisse nicht wohin. Dass ihn hier auch keiner haben wollte, ignorierte er und setzte sich jammernd auf mein Bett. Plötzlich sprang er auf, rannte in Richtung Balkon und schrie, er werde sich hinabstürzen. Wir mussten ihn mit vereinten Kräften festhalten und konnten ihn endlich wieder aus der Wohnung werfen. Danach ging die Party weiter.
- Irgendwann gab der Freund, der Mali fast umgebracht hatte, ihm als Entschädigung eine große Summe Geld – ich glaube, so um die 8.000 Euro. Davon kaufte sich Mali als erstes eine wunderschöne blonde Echthaarperücke und erklärte schließlich, er werde jetzt nach Japan ziehen. Wenig später war er weg und in die anderen beiden Zimmer (Julian war auch schon nicht mehr da) zogen zwei skandinavische Studenten. Ein Junge und ein Mädchen, die alles “super authentisch” fanden. Damit waren die Partys erstmal vorbei, obwohl ich immer die leise Hoffnung hegte, dass Malis Jungs eines Tages einfach auftauchen und den beiden Skandinaviern zeigen würden, wie authentisch das hier wirklich werden konnte.
- Nach ein paar Wochen hatte Mali das Geld in Japan durchgebracht und ging nach Thailand. Aber irgendwann war es auch da vorbei und er kam zurück. Er schrieb mir auf Facebook, dass er mich deshalb leider aus meinem Zimmer werfen müsse. Um in sein altes Zimmer zu ziehen, hätte er die Skandinavierin rauswerfen müssen, und das traute er sich aus irgendeinem Grund nicht. Ich glaube, er hatte bei mir weniger Hemmungen, paradoxerweise gerade weil er mich kannte. Aber nach den ruhigen Wochen mit den Skandinaviern konnte ich mir sowieso nicht wirklich vorstellen, wieder in Malis Zirkus zu leben. Ich räumte das Feld.
Nach Çukurcuma zog ich nach Tarlabaşı, eigentlich das viel wildere Viertel, in dem Roma, Kurden, afrikanische Migranten, Drogendealer und transsexuelle Prostituierte sich die Straßen teilten. Dort lebte ich, als ein paar Wochen später die Gezi-Proteste losbrachen.
Auch wenn Gezi offiziell wichtiger war: Die Geschichten, die ich in Çukurcuma erlebt habe, erzähle ich seit über elf Jahren immer noch gerne. Oft gruseln sich die Zuhörer dann (gut), bewundern meine Coolness, dass ich so was ausgehalten habe (gut), und sagen dann, dass dieser Mali ja wirklich ein totaler Kotzbrocken gewesen sein muss (nicht gut). Dann merke ich immer, dass ich die Geschichte vielleicht nicht ganz richtig erzähle.
Ich habe diese Geschichten so oft erzählt, dass sie mir schon selbst fantastisch erschienen.
Denn eigentlich bin ich Mali vor allem dankbar. Erstens natürlich, weil ich diese ganzen irren Storys ohne ihn nicht hätte. Aber auch, weil ich ihn trotz allem bewundert habe. Ich hatte etwas Schiss vor ihm, aber ich konnte auch nicht leugnen, dass er mich faszinierte. Er war ein echter Punk und hatte sein ganz eigenes, in seiner ganzen Verschlissenheit sehr stringentes ästhetisches System. Er arbeitete nicht, und in meiner Erinnerung verließ er fast nie bei Tageslicht die Wohnung. Aber wenn der Zirkus losging, lieferte er immer eine tadellose Show. Die Kostümierung, die Perücken und das Make-up zeugten immer von einer morbiden Eleganz, die sich sogar mir, dem biederen Hetero-Deutschen, mühelos erschloss. Außerdem hatte er einen sehr guten und sehr eklektischen Musikgeschmack – mehrmals spielte er mir deutsche Lieder vor, die ich selbst noch nie gehört hatte. Und: Obwohl mein Türkisch nie ausreichte, um das Geplänkel zu verstehen, begriff ich schnell, dass Mali immer der Witzigste im Raum war. Kein Zweifel, Mali konnte fies sein – aber er war dabei immer auch komisch.
Ein weiteres Problem ist, dass ich diese Geschichten so oft erzählt habe, dass sie mir oft selbst fantastisch erscheinen. Dazu kommt, dass ich nicht alles selbst erlebt habe. Die Geschichten eins, zwei und vier hatte ich zum Beispiel nur von Julian gehört, der besser Türkisch sprach als ich. Und vieles von dem, was Mali damals tat, verstehe ich bis heute nicht.

Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut an den Moment, als Mali mich anschaute und sagte: “You’re so weird, you know. I don’t really understand what you do here. You don’t work, you just make little drawings, what do you do?” Ich konnte es kaum glauben. Mali fand mich seltsam? Mali verstand nicht, wovon ich lebte? Der Grand Wizard of Weirdness, der Thin White Duke of Debauchery hielt mich für einen Tagedieb? Ich war so überrascht, dass ich nicht wusste, was ich ihm antworten sollte. Was dachte er denn, wie er nach außen wirkte?
Ich bin in den letzten elf Jahren nie auf die Idee gekommen, Mali noch einmal zu kontaktieren. Aber als ich im Februar überlegte, was ich zu unserem letzten Magazin beitragen kann, kam mir die Idee: Ich reise zurück nach Istanbul, um Mali zu finden. Zum Ende unseres kleinen Punk-Magazins wollte ich herausfinden, was aus dem härtesten Punk, den ich je kannte, geworden ist – und aus dieser Stadt und ihrem Aufstand, der mir damals so viel bedeutet hat.
Vor meiner Abreise schreibe ich den gemeinsamen Bekannten, an die ich mich noch erinnern kann. Ob sie irgendeine Ahnung haben, was aus Mali geworden ist? Keiner antwortet. Als ich in das Flugzeug steige, weiß ich also nicht, wie ich Mali überhaupt finden soll. Bei der Ankunft verfliegen dann aber alle Zweifel: Es lohnt sich immer, nach Istanbul zu kommen.
Istanbul ist nicht einfach eine bedeutende Stadt, es ist die Stadt. Das sagt schon der Name, der sich aus der griechischen Floskel “eis tḕn pólin” entwickelt hat, “in die Stadt”. Noch heute kommt keine andere an das Wunder heran, das sich um den Bosporus und das Goldene Horn herum auftürmt. Wer sich für Geschichte interessiert, kann sich gar nicht dagegen wehren, bei jedem Schritt auf Istanbuls Straßen eine Art Elektrizität zu spüren. Genau wie Rom war Istanbul immer eine Stadt der größenwahnsinnigen Herrscher, der übergeschnappten Bauprojekte und der entfesselten Mobs. Aber anders als Rom ist sie das auch heute noch.

Allein die Bauten: In den elf Jahren, seit ich die Stadt verließ, hat Erdoğans Regierung Istanbul mit mehreren Megaprojekten beschenkt: einem gewaltigen neuen Flughafen, dem größten Europas, für den 13 Millionen Bäume gerodet wurden und bei dessen Bau nach manchen Schätzungen mehr als 400 Arbeiter ihr Leben ließen; dem Marmaray- und dem Eurasien-Tunnel, den tiefsten Unterseetunneln der Welt, die den Bosporus unterqueren und so den europäischen mit dem asiatischen Teil der Stadt per U-Bahn und Auto verbinden; einer imposanten dritten Brücke über den Bosporus oben im Norden; einer komplett neu aus dem Boden gestampften Riesenmoschee am Taksim-Platz; dem Fernsehturm Küçük Çamlıca auf der asiatischen Seite, der mit seinen 369 Metern das höchste Bauwerk in der Türkei ist und von seinem fernen Hügel aus auf die Stadt starrt wie Saurons Turm.
Auf dem Weg zu meinem alten Viertel fällt mir aber auch auf, wie viel immer noch da ist: die verwinkelten Gassen und alten Palazzi von Pera, die Rufe der Straßenverkäufer, die Maronen, Maiskolben und Miesmuscheln anbieten, die Müllsammler mit ihren riesigen Säcken, das alte Portal des griechischen Zoğrafyon-Gymnasium. Dann erreiche ich Cihangir. Das Viertel bildete vor elf Jahren das Epizentrum der Istanbuler Intelligenzija: In den Teehäusern, Hipster-Cafés und Kneipen tranken progressive Intellektuelle und kritische Journalisten zusammen mit berühmten Schauspielern und Filmemachern. Und heute? Mein Lieblingsplatz um die grüne Firuz-Ağa-Moschee hat sich auf den ersten Blick kaum verändert, ich erkenne viele der Cafés wieder, es liegt immer noch derselbe Duft von Kaffee, Zigarettenrauch und Blumen in der Luft.
Was allerdings verschwunden ist, sind viele der Leute, die ich damals kannte. Cengiz zum Beispiel, ein Filmemacher, der mir auf meine E-Mail antwortet, dass er schon seit acht Jahren in Toronto lebt. “Wie die meisten meiner Freunde bin ich abgehauen, ich komme nur noch im Sommer zurück”, schreibt er. “Es ist immer noch super, aber über die Regierung muss man die Klappe halten.”

Was ich lange nur nebenbei verfolgt habe, wird mir hier sehr präsent: Die vergangenen elf Jahre in der Türkei waren hart. Nachdem die Polizei die Gezi-Aufstände in Grund und Boden geknüppelt hatte, ließ Erdoğan seinen autokratischen Tendenzen immer freieren Lauf. Sobald er 2014 Präsident wurde, verbot er sämtliche öffentliche LGBT-Aktivitäten. Seitdem wird die jährliche Istanbul-Pride regelmäßig von der Polizei gesprengt. Der stümperhafte Coup-Versuch der Gülenisten im Juli 2016 kostete viele Menschen das Leben und stieß eine neue Welle von Säuberungen los. Im Jahr darauf gewann Erdoğan das Referendum, das die Türkei in ein Präsidialsystem umwandelte und ihm noch mehr Macht verlieh. Gleichzeitig wurde die Türkei in diesen Jahren von einer beispiellosen Terrorwelle erschüttert, in der Selbstmordattentäter des Islamischen Staats, aber auch kurdische Extremisten scharenweise Zivilisten abschlachteten.
“Das waren die schlimmsten Jahre”, sagt der Journalist und Autor Kaya Genç am Telefon. “Alle unsere Freunde wurden verhaftet, meine Herausgeber, meine Kollegen. Damit sendete die Regierung ein Signal.” Die Regierung habe damals genau recherchiert, wer im kritischen Kulturbetrieb in Cihangir die Fäden zog, und die Produzenten, Kuratoren und Autoren dann sehr gezielt aus dem Verkehr gezogen. “Es war eine düstere Zeit für alle, die an das geglaubt hatten, was wir manchmal ‘Republik Cihangir’ nannten.”

Tatsächlich hat Erdoğan seinen Marsch zum Voll-Autokraten seither nur beschleunigt. Letztes Jahr, zum hundertsten Geburtstag der türkischen Republik und zehnten der Gezi-Aufstände, hatten sich noch einmal alle Gegner der AKP hinter dem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu zusammengetan, um Erdoğan endlich vom Thron zu stoßen. Und genau wie beim Referendum 2017 sind sie gescheitert, Erdoğan ist heute mächtiger denn je. Für Kaya Genç bedeutet das aber auch eine perverse Erleichterung. “Wenigstens gibt es keinen Bullshit mehr. Erdoğan behauptet nicht mal, ein demokratischer Anführer zu sein. Ich glaube, das ist gesünder. Wir haben keine Illusionen mehr.”
Von Cihangir sind es nur ein paar Schritte zu dem Haus, in dem ich damals mit Mali gelebt habe. Es sieht heute noch genauso angeschlagen aus. Ganz unvermittelt kommt mir eine weniger abgeschliffene Erinnerung an Mali zurück: Wie er ganz aufgeregt war, als er von meinen Versuchen erfuhr, mir selbst das Tätowieren beizubringen. Er wollte unbedingt ein umgedrehtes Kreuz von mir haben, obwohl ich damals noch nicht mal auf einer Schweinehaut geübt hatte. “I don’t care if it looks shit, I want it that way!”, sagte er mit leuchtenden Augen. Ich versprach, ihn zu tätowieren, sobald ich weiß, wie herum man die Maschine hält.
Heute hat das Haus immerhin eine moderne Klingelanlage. Im unserem Stock meldet sich niemand, aber aus dem dritten antwortet eine männliche Stimme. Unwirsch sagt er, dass er mich nicht hereinlasse. Als ich frage, wer heute im vierten Stock wohnt, erfahre ich, dass es jetzt ein Airbnb ist. Ich versuche, die Wohnung auf Airbnb zu finden, ohne Erfolg. Ich kann nur zu unserem Stockwerk hochstarren und mich fragen, wie viel von der ursprünglichen Wohnung wohl übrig geblieben ist. Als ich das Straßenschild “Altıpatlar Sokak” sehe, wundere ich mich, wie ich die Adresse dermaßen vergessen konnte – und mir kommt die Idee, in meinen eigenen E-Mails danach zu suchen. Und da sind sie: unsere allerersten E-Mails, mit Malis Adresse von vor zwölf Jahren. Ich schreibe ihm, große Hoffnung habe ich allerdings nicht.

Danach gehe ich die Sıraselviler Caddesi zum Taksim hoch. Diese beschauliche Straße, die aus dem Herzen Cihangirs direkt zum Platz führt, wurde im Juni 2013 plötzlich zu einer der Hauptfronten zwischen Demonstranten und Polizei. Anderthalb Tage lang wogte der Kampf hier zwischen Barrikaden aus brennendem Mülleimern und Beton-Blumenkästen. Anderthalb Tage lang versuchte die Polizei, die immer wieder anbrandende Menge mit Tränengas zurückzudrängen, bis die Uniformierten sich abrupt zurückzogen und den Weg zum Taksim frei machten. Heute ist davon nichts mehr zu sehen. Vor dem Krankenhaus, in das ich eine Freundin bringen musste, der eine Tränengaskartusche eine Platzwunde in die Stirn geschlagen hatte, stehen ein paar Krankenpflegerinnen mit Kopftuch und plaudern.
Der Taksim-Platz ist immer noch so wuselig und ungemütlich wie vorher, allerdings wird er jetzt von zwei sehr großen Neubauten eingerahmt. Beide wurden erst 2021 fertig: die riesige Moschee und das neue AKM, kurz für Atatürk Kültür Merkezi. Zu meiner Zeit war das AKM eine völlig verfallene Ruine. Die Gezi-Protestanten hatten sie damals übernommen und mit Dutzenden Plakaten behangen. Jetzt steht dort ein an dem alten Entwurf orientierter, aber ultramoderner und eigentlich sehr gelungener Neubau. In seinem Inneren scheint eine große rote Kugel zu schweben, die sich als Opernsaal herausstellt. Ich lese, dass hier am Abend die Rossini-Oper über Mehmet II. aufgeführt wird, kaufe mir ein Ticket und gehe dann weiter in Richtung Gezi-Park.
Der Park, dessen geplanter Abriss damals die Proteste auslöste, ist heute zwar noch da, vom Taksim aber kaum zu sehen. Blockiert wird er von einer Art Parkplatz, der mit einem Wasserwerfer, einem Schützenpanzer, Absperrgittern, Truppentransportern und zivilen Autos vollgestellt ist, bewacht von Polizisten mit Maschinenpistolen. Der Park dahinter ist allerdings auch nicht viel einladender. Zwar hat die Regierung – wohl als versöhnliche Geste – die Anlagen kurz nach den Protesten runderneuert und frisch aufgeforstet. Allerdings ist der Park so angelegt, dass man sich überall vage beobachtet fühlt. Die Hälfte der Männer auf den Bänken sieht aus wie Zivilpolizisten, ein richtiges Parkgefühl will nicht aufkommen.

Ich versuche mir in Erinnerung zu rufen, wie es hier auf dem Höhepunkt der Proteste aussah: Alles voller Zelte, in denen Demonstranten schliefen, dekoriert von unzähligen selbstgemalten Bannern. Dazwischen Volksküchen und Erste-Hilfe-Stationen. Der Park war immer brechend voll, dauernd gab es spontane Ansprachen, Konzerte, Volkstänze oder sogar Yogakurse. Die Menschen, die Erdoğan stets nur als “capulçular”, also Plünderer, bezeichnete, entfalteten eine ungeheure Kreativität, Lebensfreude und trotzigen Mut – das, was Deniz Yücel mal “den Gezi-Geist” nannte. Vieles war naiv, aber für eine kurze Zeit wurde hier eine echte demokratische Utopie zelebriert. “Gegen den Faschismus, Schulter an Schulter” war mehr als eine Floskel: Vor allem junge Menschen, die bisher völlig unpolitisch gewesen waren, lehnten sich im Schulterschluss mit Umweltschützern, Queeren, Säkularen, antikapitalistischen Muslimen, Aleviten, Sozialisten, Liberalen, Kurden und Armeniern gegen die autoritäre Regierung auf.
In den vierzehn Tagen, in denen die Demonstranten hier kampierten, schrieben sie türkische Geschichte: Sie erprobten einen Gegenentwurf zu Erdoğans Türkei. “Die Leute hatten damals das Gefühl, dass sie es mit Gleichgesinnten zu tun haben”, sagt Kaya Genç. “Sie wollten dasselbe und waren bereit, ihre Karriere, sogar ihr Leben dafür zu riskieren. Die Menschen wollten ein moralisches Leben leben.” Solidarische Schultern statt Ellbogen, Kooperation statt Kapitalismus, Redefreiheit statt Repression. Mit dem Ruf “Taksim ist überall, Widerstand ist überall” erfasste dieser Geist für eine kurze Zeit das ganze Land. Ich frage mich, was davon heute noch übrig ist.
Und dann, wenige Stunden nachdem ich ihm geschrieben hatte, antwortet Mali. Sehr ausführlich. Er bedankt sich für meine E-Mail und erklärt, dass er sich gerade in einer “komplexen, herausfordernden, komplizierten” Phase seines Lebens befindet. Er schreibt, dass er letztes Jahr “endlich herausgefunden hat, wo all die Weirdness, die mich umgab” herkam, und listet mir dann auf, was alles bei ihm diagnostiziert wurde: Autismus, Zwangsstörungen, fünf bis sechs verschiedene Angststörungen, ADHS, Schlaf- und Essstörungen, Restless-Legs-Syndrom und noch einige mehr. Und er schreibt, dass meine E-Mail ihn sehr bewegt habe. Es wäre für ihn sehr „wertvoll“, sich mit mir zu treffen, da auch er viele Fragen zu dieser Zeit habe und sich viel davon verspreche, mit mir darüber zu reden. Er endet mit “in aller Aufrichtigkeit” und mehreren Herz-, Sonnen-, und Bet-Emojis, und ganz am Ende mit einem roten Ballon.
Auf einmal explodiert mein schlechtes Gewissen. War ich die ganze Zeit der Kotzbrocken?
Kurz: Es ist eine der liebevollsten Nachrichten, die ich seit Langem bekommen habe, und sie kommt von Mali.
Auf einmal explodiert mein schlechtes Gewissen. War ich die ganze Zeit der Kotzbrocken? Wie konnte ich so kalt sein? Dieser Mensch ist fast gestorben, weil ein Freund ihm den Hals aufgeschlitzt hat, und ich mache daraus eine Geschichte, um zu zeigen, wie wild meine Zeit in Istanbul war? Ich lese über Autismus-Spektrums-Störung im Erwachsenenalter und erfahre, dass nichtdiagnostizierte Betroffene oft wahnsinnig hart arbeiten, um ihre zwischenmenschlichen Schwierigkeiten zu kompensieren und zu verbergen. Das wird manchmal als Camouflaging bezeichnet und ist so anstrengend, dass es laut mehreren Studien Depressionen, Ängste und ein erhöhtes Stressempfinden auslösen kann. Dazu kommen die sogenannten Komorbiditäten, eben die von Mali erwähnten Probleme wie ADHS, Angststörungen und sogar Magenbeschwerden. Hätte ich nicht merken müssen, dass Mali unter dem Panzer seiner Coolness an Problemen litt, die ich mir nicht einmal vorstellen kann? Für die er selbst nicht einmal die richtige Sprache hatte?
Und ja, es war nicht nur lustig, praktisch im beliebtesten Szeneclub der Stadt schlafen zu müssen – aber was wusste ich eigentlich davon, wie hart das Leben für Leute wie Mali in einer Stadt wie Istanbul war? Vielleicht war unsere Wohnung einer der wenigen Safe Spaces, in denen seine Freunde und er sich ausleben konnten, ohne angegriffen zu werden?
Ach ja: Er schreibt außerdem, dass er seit mindestens fünf Jahren in Berlin lebt.
Aufgeregt antworte ich, bedanke mich sehr und sage, dass wir uns unbedingt treffen sollten, sobald ich aus Istanbul zurück bin. Ich frage ihn, ob er mir einen Kontakt zu Freunden von damals vermitteln könnte, die noch in Istanbul leben. Aber fürs Erste bekomme ich keine Antwort mehr. Also mache ich mich auf den Weg in die Oper.
In einem aufgedonnerten Gebäude zu sitzen, das man nur als nackte Ruine kannte, ist ein komisches Gefühl. Während sich auf der Bühne Erisso, Anna und Maometto durch das eher zähe Libretto von Rossini arbeiten, muss ich daran denken, wie wir hier während der vierzehn Tage Anarchie ein- und ausgegangen sind. Vorbei an den frei hängenden Kabeln und rostenden Stahlträgern kletterten wir die alten Treppen hoch. Ganz oben wurden wir mit einem unglaublichen Blick belohnt: hinter uns der Bosporus, vor uns der mit Menschen vollgepackte Taksim. Hier oben hatten die Fußballfans von Beşiktaş den Triumph der Demonstranten über die Polizei mit Hunderten Bengalos gefeiert. Jetzt sitze ich hier mit der türkischen Bourgeoisie und hoffe heimlich, dass Maomettos Pferd auf die Bühne scheißt.

Und dann erreicht mich eine neue E-Mail: Emrah, der sich als einer von Malis ältesten Freunden vorstellt, will sich mit mir treffen. Offenbar hat Mali ihn dazu angestiftet. Ich bin aufgeregt, denn das hier ist der erste Kontakt mit jemandem, der zumindest bestätigen kann, dass ich das alles damals nicht geträumt habe.
“Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nicht über Mali zu reden”, sagt Emrah, als ich ihn in einem Restaurant in einer Seitengasse der Istiklal treffe. Dann kann er sich aber doch nicht bremsen, so sehr freut er sich, einen weiteren Verehrer Malis gefunden zu haben. “Mali war der ultimative Punk, er war die Muse unserer Szene”, schwärmt er. “Jeder, der auch nur eine Party in dieser Wohnung erlebt hat, hat das gespürt”, sagt er. “Drogen, komische Tänze, dunkle Zeremonien – und Mali war immer so etwas wie der Voodoo-Priester, der spirituelle Anführer dieser Partys. Er hat sie gelenkt, und er hatte einen großartigen Musikgeschmack.”
Von Emrah erfahre ich, dass Mali durchaus auch gearbeitet hat, aber eigentlich immer nur, “um sich zu erholen und ein bisschen Abstand von der Szene zu bekommen”. Dann arbeitete er zum Beispiel mal für drei Monate in einer Bucht im Süden der Türkei. “Einfach, um wieder in Kontakt mit der normalen Welt zu treten – aber immer nur kurz.”
Emrah erzählt von der Szene damals, und dass es sich für ihn damals nicht gefährlich angefühlt habe, als verkleideter Schwuler durch Istanbul zu laufen. “Wenn wir kritisiert wurden, dann eher, weil es Leute genervt hat, dass wir so auf Drogen waren”, sagt er und lacht. Das beruhigt mein schlechtes Gewissen ein bisschen. Vielleicht bin ich doch nicht so ein Kotzbrocken.
Als ich gestehe, dass Mali für mich immer irgendwie ein Rätsel blieb, wird er ernst. “Er ist auch schwer zu verstehen. Er kann gemein sein. Aber gleichzeitig ist er der sensibelste und sanfteste Mensch, den ich kenne. Und ich kenne ihn jetzt schon seit fünfzehn Jahren.” Dann lacht er wieder. “Oh Gott, Mali ist bestimmt böse, wenn ich erzähle, dass er sensibel ist. Er will lieber als gemein gelten.”

Am Ende unserer Unterhaltung sagt mir Emrah noch, dass er nicht glaubt, dass ich Mali noch vor Redaktionsschluss dazu kriegen werde, mit mir zu reden. “Er braucht Zeit für so was, er muss sich vorbereiten.” Und er sollte recht behalten: Bis Redaktionsschluss hat mir Mali auf keine meiner vielen E-Mails mehr geantwortet. Aber jetzt, da ich weiß, dass er in Berlin lebt, kann ich mir trotzdem gut vorstellen, ihm eines Tages über den Weg zu laufen. Dann werde ich mich sehr freuen.
Aber selbst wenn nicht, werden mir Emrahs Worte in Erinnerung bleiben. “Mali ist der originellste Mensch, dem ich in meinem ganzen Leben begegnet bin. Du hattest Glück, dass du ihn eine Weile miterleben durftest.”
Emrah hat recht, ich hatte damals sehr viel Glück. Nicht nur mit Mali. Die Zeit, in der ich in Istanbul lebte, sorglos und zufrieden wie ein Fisch in der Raki-Flasche, gilt offenbar noch heute als die beste, die Istanbul je erlebt hat – das wird mir auf dieser Reise immer wieder gesagt. Und dann auch noch Gezi: Alle, die dabei waren, bekommen ein Leuchten in den Augen – alle, die es verpasst haben, sind untröstlich. Aber sicher ist, dass ich vor elf Jahren gleich dreimal das Glück hatte, etwas einmaliges zu erleben: das freiste Istanbul, das es je gab, die Gezi-Proteste, und Mali. Was kann man mehr verlangen?
Folge Matern bei X/Twitter und Threads.
The post Mali’yi Bulun – Finding Mali appeared first on VICE.













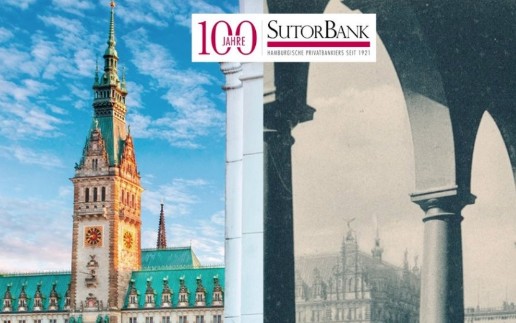



:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4b/25/4b25b0cedaa3f057d79b61a64bbf06d5/0122517375v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3d/d1/3dd1e558dd7ae91102d7ce4753208ae4/0122134693v1.jpeg?#)






















































