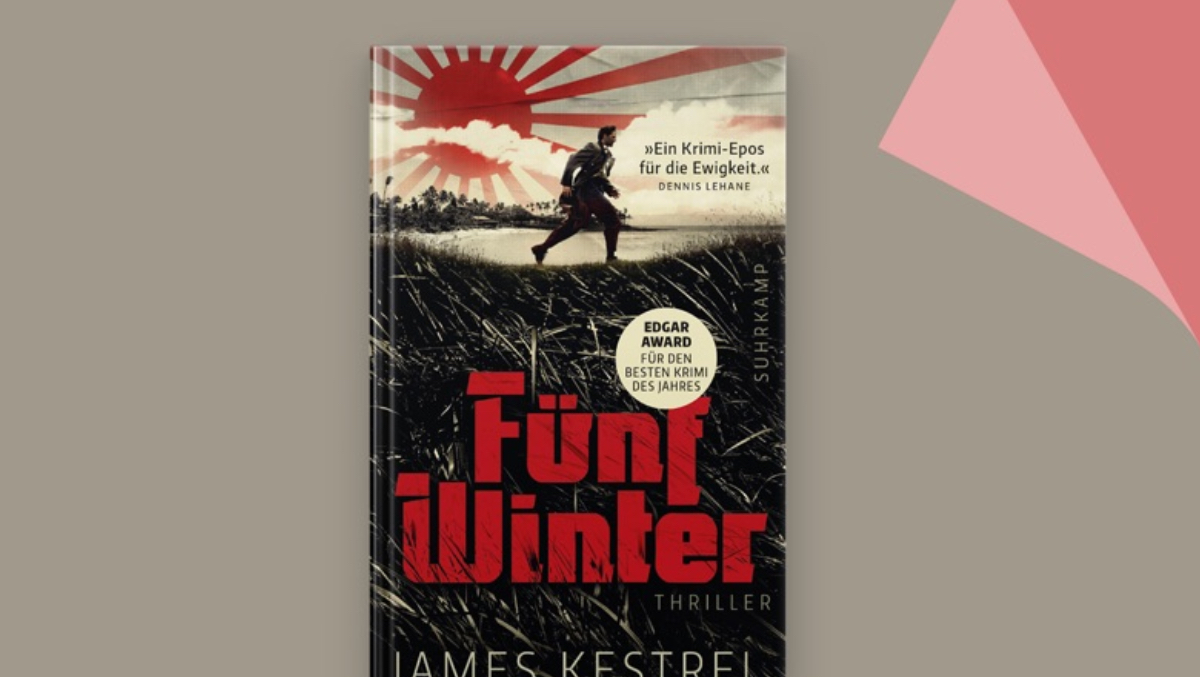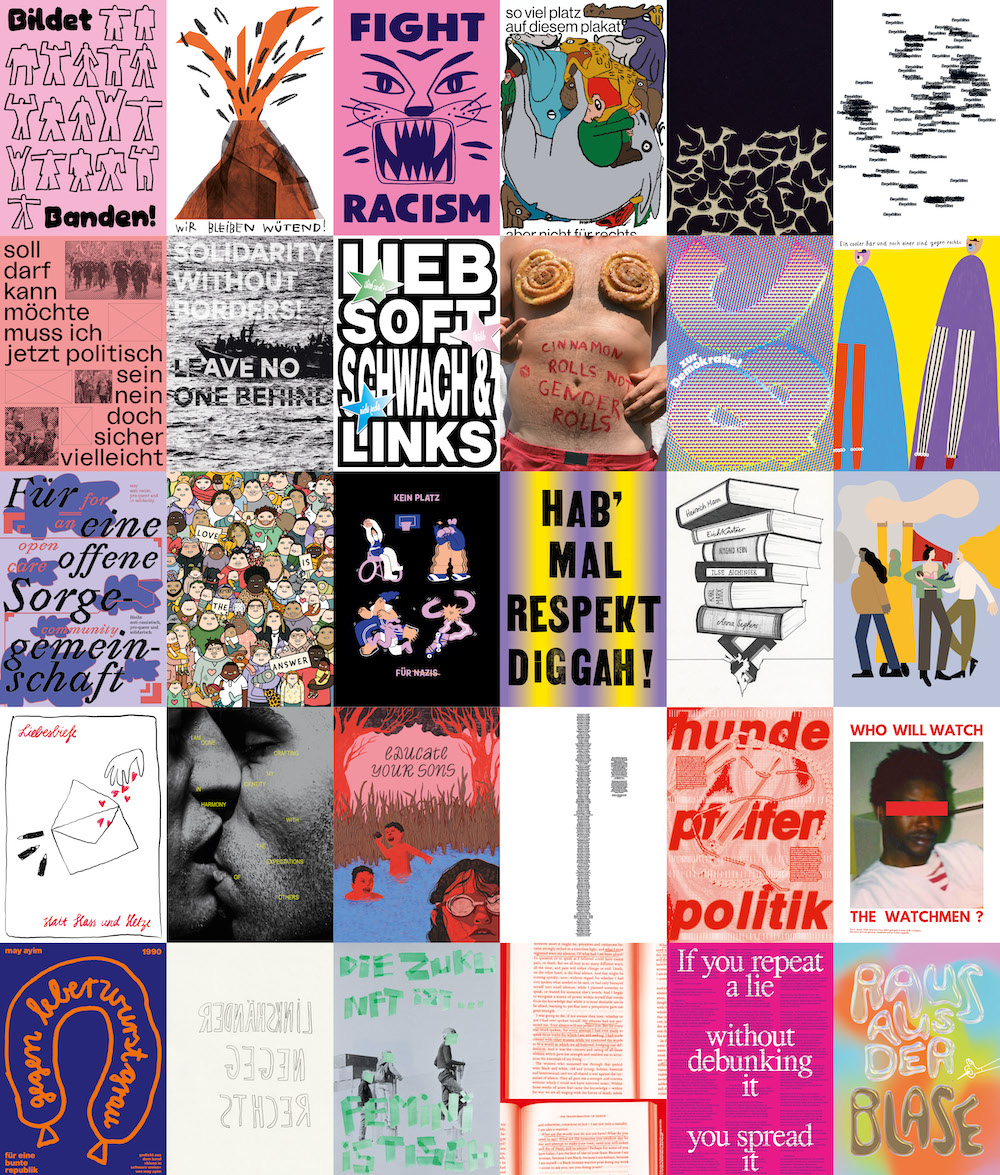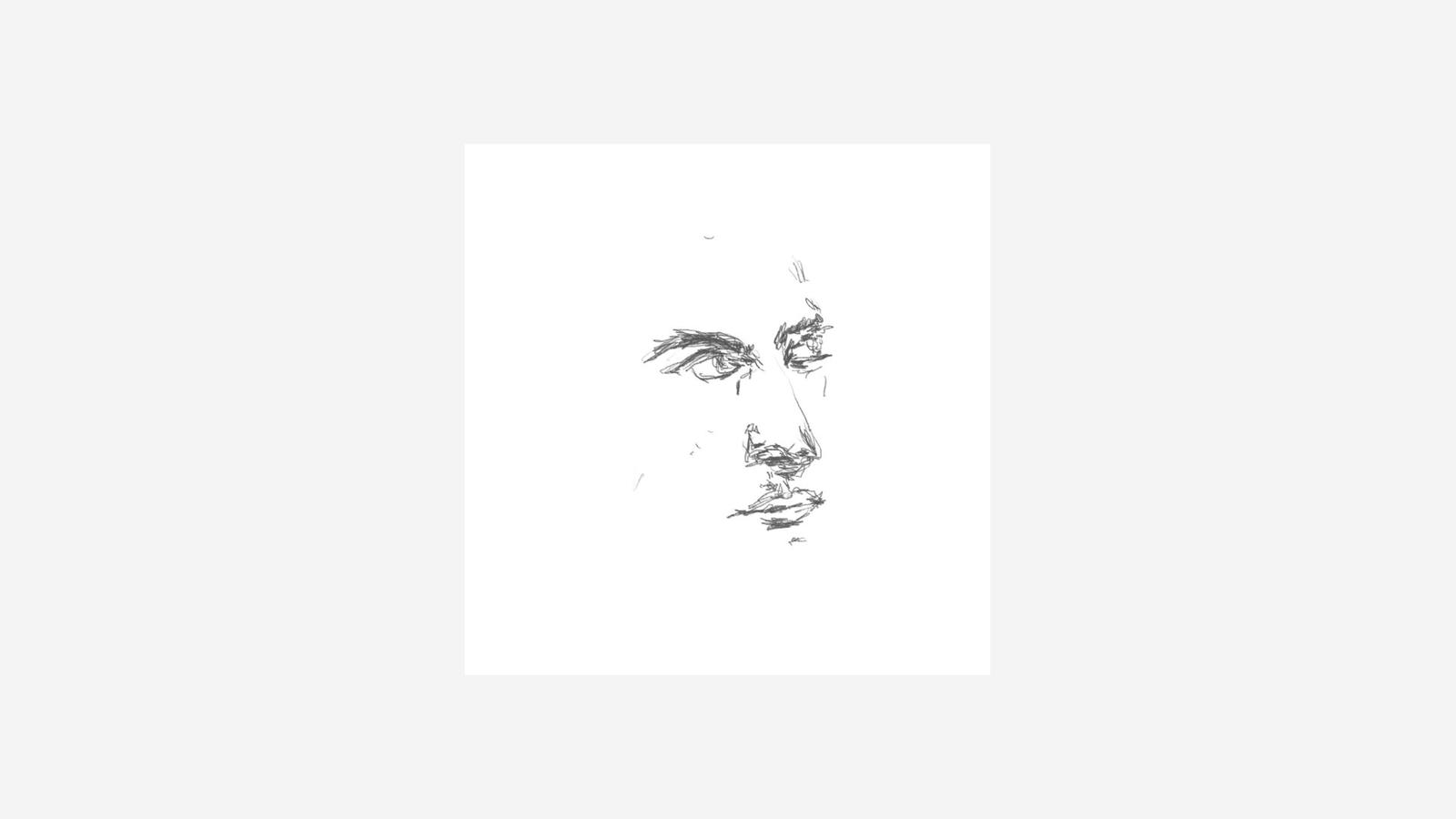Die Mensch und Computer 2024 – Raum für neue Impulse & ganz viel Barrierefreiheit
Dieses Jahr fand das große Treffen der deutschsprachigen UX-Szene am KIT in Karlsruhe statt. Unter dem Motto “Hybrid Worlds” trafen sich ca. 600 […]

Dieses Jahr fand das große Treffen der deutschsprachigen UX-Szene am KIT in Karlsruhe statt. Unter dem Motto “Hybrid Worlds” trafen sich ca. 600 UX-Professionals und Studierende aus Wissenschaft und Praxis. Im wissenschaftlichen Teil gab es u.a. 30 Papers, 54 Short Papers, 17 Demos und 20 Workshops & Tutorials. Im Praxisteil gab es 24 Workshops & Tutorials, 29 Vorträge und 40 Barcamp-Sessions. Im Barcamp der German UPA ging es u.a. um persönliche Kompetenzen für UXler:innen, künstliche Intelligenz für die UX-Arbeit, datenbasierte UX-Messung, Barrierefreiheit, Stakeholder-Management, strategisches Handeln im UX-Bereich, Jobsuche im UX-Bereich und das Testen der Erfüllung von Bedürfnissen.
Insgesamt hat es sich mal wieder richtig gelohnt auf die Mensch und Computer zu fahren. Vor allem wegen des Netzwerkens, guter Denkanstöße und weil es einfach ein guter Ort ist, um sich als Arbeitgeber für UXler:innen zu präsentieren. Die außergewöhnlich gute Organisation inkl. einer legendären Abendveranstaltung hat die Konferenz schön abgerundet. Aber es gab trotz der Schlosslichtspiele nicht nur Licht.
Viel Raum für neue Ideen, mutige Theorien und Tatendrang
Bevor ich zu den inhaltlichen Themen komme, möchte ich gern ein paar allgemeine Beobachtungen mit Dir teilen. Ich besuche nun schon seit über 20 Jahren die Mensch und Computer. Ich war 2003 in Stuttgart dabei, als zum ersten Mal ein Praxistrack der neu gegründeten German UPA angeboten wurde. Gerade in den ersten Jahren war die Konferenz eine der wichtigsten Lernquellen für meine berufliche Laufbahn. Und, sie war ein großer Motivator. Immer wieder gab es Menschen, die durch ihre professionelle Arbeit zu meinen großen Vorbildern wurden und mich anspornten, immer besser zu werden.
Seit einigen Jahren nehme ich jedoch grundlegende Veränderungen wahr. Die Konferenz kann inhaltlich nur noch bedingt mit der beruflichen Praxis mithalten.
Beobachtung 1: Die UX-Vordenker:innen der ersten Stunde verlassen so langsam das Berufsleben. Sie haben ihre Unternehmen verkauft oder bereiten sich langsam auf den Ruhestand vor. Es fehlen neue und fundierte Impulse aus der unternehmerischen Praxis, insbesondere aus den UX-Agenturen und Dienstleistungsunternehmen, die unsere Profession und damit auch die Unternehmen in Sachen UX voranbringen.
Beobachtung 2: Die wissenschaftlichen Beiträge waren teilweise zu praxisfern. Aus meiner Sicht ist es wenig hilfreich, wenn zum hundertsten Mal Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) wissenschaftlich erforscht werden, ohne dass ein Bezug zu realen menschlichen Bedürfnissen oder unternehmerischen Anforderungen besteht. Das entspricht nicht den aktuellen Herausforderungen, vor denen die UX-Disziplinen und Unternehmen stehen. Dies soll aber keine Pauschalkritik sein. Dass es auch anders geht, zeigte nämlich unter anderem Pia Maria Packmohr (usetree) in ihrem Beitrag. Im Forschungsprojekt ARES (https://ares-projekt.info/) wird untersucht, wie mit Hilfe von AR- und KI-Assistenzsystemen die Kampfmittelräumung verbessert werden kann. Sie stellte einen Prototyp vor, der das Aufspüren von Kampfmitteln auf Grundstücken erleichtert. Sie erläuterte den nutzerorientierten HCD-Prozess inklusive der technischen Herausforderungen.
Beobachtung 3: Es fehlt an wissenschaftlichem Nachwuchs, der Theorien zu HCI und UX kritisch hinterfragt und neue Theorien aufstellt – gerade weil sich derzeit so viel verändert. In seiner Eröffnungskeynote beklagte Kasper Hornbæk auf Basis seiner Beobachtungen als Reviewer der CHI-Konferenz, dass in vielen wissenschaftlichen Beiträgen bestehende Theorien zu Human Computer Interaction und UX einfach unreflektiert verwendet oder zitiert werden. Es fehlt eine kritische Auseinandersetzung und Rückkopplung zwischen Theorie und Praxis. Ein anderes Beispiel für ein praxisnahes Forschungsprojekt war der Beitrag von Anastasiya Zakreuskaya. Sie stellte die Erkenntnisse einer Beobachtungsstudie vor, in der die Bedeutung von Entlassungsbriefen für die internen Abläufe in einem Krankenhaus untersucht wurde.
Insgesamt würde ich sagen, dass es in den UX-Disziplinen wieder viel Raum für neue Ideen, mutige Theorien und Tatendrang gibt. Das ist eine echte Chance für die aktuelle und nachwachsende Generation von UXler:innen. Ergreife sie und bringe die Disziplin UX und dich selbst voran.
Barrierefreiheit
Das Hauptthema der Konferenz war Barrierefreiheit. In zahlreichen Vorträgen, Workshops und Barcamp-Sessions wurde über Barrierefreiheit auf verschiedenen Ebenen gesprochen und diskutiert. Das reichte von Tipps und Tricks für die Entwicklung barrierefreier Produkte bis hin zur Etablierung von Barrierefreiheit in Unternehmen. Kein Wunder, denn die Verpflichtung zur Barrierefreiheit rückt für einige Unternehmen in greifbare Nähe. Persönlich freue ich mich, dass Barrierefreiheit als Fachthema so viel Aufmerksamkeit erfährt. Aus fachlicher Sicht erhoffe ich mir jedoch eine weitere Schärfung der Gesetzgebung. Derzeit ist die “Verpflichtung” aus meiner Sicht eher ein Papiertiger als ein wirksames Instrument. Sonst bleibt nach der aktuellen Aufmerksamkeit nur Ernüchterung bei Beteiligten und Betroffenen.
UX-Management
Es war schön zu sehen, dass neben vielen operativen Fachthemen endlich wieder mehr UX-Management-Themen in das Programm aufgenommen wurden.
Andreas Hinderks und Dominique Winter arbeiteten in einem Workshop mit den Teilnehmenden an möglichen praktischen Lösungen für Herausforderungen im UX Management. Dabei ging es um Fragen wie:
- Wie schaffe ich es als UX-Manager:innen, ein konsistentes Verständnis von UX in meinem Unternehmen zu etablieren?
- Was beinhaltet die Rolle “UX-Manager:in”?
- Wie erreichen UX-Manager:innen Wirksamkeit?

Michaela Thölke und Max Wittenberg-Voges (usability.de) stellten in ihrem Beitrag ein Workshop-Format vor, das Teams dabei unterstützt, Verbesserungspotenziale in Bezug auf den UX-Reifegrad zu identifizieren. Dabei werden insbesondere
- die Vollständigkeit des menschzentrierten Designs
- Kompetenzen, Rollen und Organisation: Verantwortlichkeiten für UX
- UX Entscheidungen und Kommunikation
- Anwendungsfelder menschzentrierter Gestaltung
- UX messen
- Zielbild und Vision
- UX-Wissensmanagement
betrachtet.
Holger Fischer stellte die dezentrale Designorganisation von Atruvia vor. Die UX-Community bei Atruvia ist in den letzten Monaten sehr stark gewachsen. Das ist natürlich erfreulich, bringt aber auch große Herausforderungen für das Management der UX-Community mit sich. Die größte davon ist die Einigung auf gemeinsame Regeln und Werte sowie die Schaffung einer gemeinsamen Vorgehensweise (Designkultur). Um eine gemeinsame Designkultur zu schaffen, wurden folgende Maßnahmen ergriffen:
- Einführung eines Design-Systems und einer Bibliothek mit Design-Patterns in Form von Code-Komponenten
- Etablierung eines Designboards zur Priorisierung von Designanforderungen
- Etablierung einer UX-Gilde bzw. eines regelmäßigen Austauschs innerhalb der UX-Community
- Durchführung von jährlichen UX-Days zur Vernetzung
- Vereinbarung gemeinsamer Werte für den Umgang in der UX-Community
- Wöchentliche Sparring-Gruppen
- Einführung eines Onboarding-Konzepts für neue UXler:innen
- Aufbau eines Trainingsangebots für UXler:innen

Robin Goldberg (Mercedes-Benz) bot eine Session zur Business-Sprache von UXler:innen an. Dabei ging es um die Unterscheidung von Metriken, KPIs und North Star Metriken, die Verwendung von Fachbegriffen im Management und etablierte Begriffe aus der Betriebswirtschaft. Die wichtigste Erkenntnis dieser Session war, dass UXler:innen stets solche Begriffe nutzen sollten, die im Management verstanden werden. Sie sollten nicht versuchen, die Verwendung von UX-Fachbegriffen auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Um die richtige Sprache zu treffen, sollten sie sich mit den Themen beschäftigen, die das Management beschäftigen.
Katja Busch bot unter anderem eine Session zu Methoden der Stakeholderanalyse und des Stakeholdermanagements an. Sie beschrieb, wie eine Empathy Map genutzt werden kann, um sich in Stakeholder:innen hineinzuversetzen. Sie betonte
“Je mehr wir über unser Gegenüber wissen und je besser wir diese Person verstehen, desto erfolgreicher sind wir”. Weitere Methoden waren die Resonanzanalyse und Stakeholder-Maps. Spannend war die Sammlung an Themen und Aspekten, die man bei der Analyse von Stakeholder:innen berücksichtigen sollte. Diese sind:
- Beobachtung des Verhaltens
- Fremdeinschätzung
- Selbstdarstellung, z.B. auf LinkedIn
- Mission, Ziele & persönliche Rolle
- Vertragsart und -dauer
- Persönliche Geschichte (Entscheidungen, Beziehungen und Seilschaften)
- Persönliche Erfolgsmetriken

Künstliche Intelligenz & UX
Natürlich durfte das Thema KI auf der Mensch und Computer nicht fehlen. Dies begann bereits auf der großen Bühne mit der Keynote von Nicole Göbel (DB Systel), die über den Einsatz von KI bei der Deutschen Bahn berichtete. Sie sprach beispielsweise über den DB Railmate, ein System zur Sammlung, Auswertung und automatisierten internen Verteilung von Kundenfeedback oder die Graffiti-Erkennung an Fernverkehrszügen.
Zhenni Li (Spiegel Institut) berichtete über eine unternehmensinterne Studie, in der sie den Einfluss von KI auf die Arbeit von UX Researcher:innen untersuchten. Dabei bezogen sie 4 UX Researcher:innen aus Deutschland und 7 UX Researcher:innen aus China ein. Alle UX-Researcher:innen äußerten die Hoffnung, dass KI bei der Auswertung von qualitativen Daten unterstützen kann und so Zeit für strategische bzw. kreative Themen entsteht. Dafür sind projektspezifische KI-Tools und eine bessere Qualität der Ergebnisse von KI-Tools notwendig. Derzeit können KI-Tools in der Marktforschungspraxis noch keine Aufgaben selbstständig und unbeaufsichtigt übernehmen.
Praxisberichte
Und natürlich gab es auch wieder lehrreiche Beiträge aus der Praxis. Am besten hat mir der von Ronja Scherz (DM Tech) gefallen. Sie beschrieb den nutzerorientierten Entwicklungsprozess für eine neue Software zur Lagerverwaltung in DM-Distributionszentren. Spannend war, dass es dabei um die Ablösung eines über 25 Jahre gewachsenen Softwaresystems ging. Dies ist meiner Erfahrung nach eine der größten Herausforderungen im B2B-Bereich. Aus den gewonnenen Erkenntnissen folgerte sie unter anderem, dass
- UX Teil des Entwicklungsteams sein sollte,
- Workarounds, die sich Anwender:innen über die Jahre aufgebaut haben, eine gute Quelle für Innovationen sind und
- regelmäßiger Kontakt mit Nutzer:innen ein Erfolgsfaktor für erfolgreiche Software ist.
Martin Schrepp (SAP) stellte in seinem Beitrag ein Projekt zur Etablierung einer kontinuierlichen UX-Messung in SAP-Produkten auf der SAP Business Technology Platform (BTP) vor. Kern der kontinuierlichen UX-Messung ist ein Fragebogen, der neben demographischen Daten und Nutzungsverhalten das Erlebnis der Anwender:innen über die Metriken PSAT, UX-Lite, UEQ-S und NPS misst. Der Fragebogen wird über Feedback-Buttons, Feedback-Dialoge, Email-Kampagnen und Social Media an die Anwender:innen ausgespielt. Die Auswertung erfolgt über Qualtrics mit Hilfe von ChatGPT. Da man ChatGPT aber noch nicht ohne Überprüfung verwenden kann, werden die Ergebnisse noch von den Fachkolleg:innen überprüft. Die erhobenen Daten werden allen Mitarbeiter:innen in Form von UX Scores über Dashboards zur Verfügung gestellt.
Und sonst noch so
Zum Schmunzeln brachte mich der Beitrag von Maximilian Altmeyer. Er ging mit anderen Fachkolleg:innen der Frage nach, wie man Büromenschen dazu bewegen kann, öfter mal aufzustehen. In einer schön gestalteten Studie entwickelten sie die Konzeptidee einer Blume, die durch ihr eigenes Verwelken (Bewegung und Licht) darauf aufmerksam macht, dass man mal wieder aufstehen sollte.
Alles in allem war die Organisation von Mensch und Computer rundum gelungen. Insbesondere die legendäre Abendveranstaltung im ZKM Karlsruhe und die Schlosslichtspiele werden mir noch lange in Erinnerung bleiben.
Ich möchte mich an dieser Stelle explizit beim Organisations- und Programm-Kommitee, der German UPA, den vielen Unterstützer:innen und natürlich bei allen Teilnehmer:innen für die bereichernde und gelungene Konferenz bedanken.
Ich freue mich auf’s nächste Jahr.




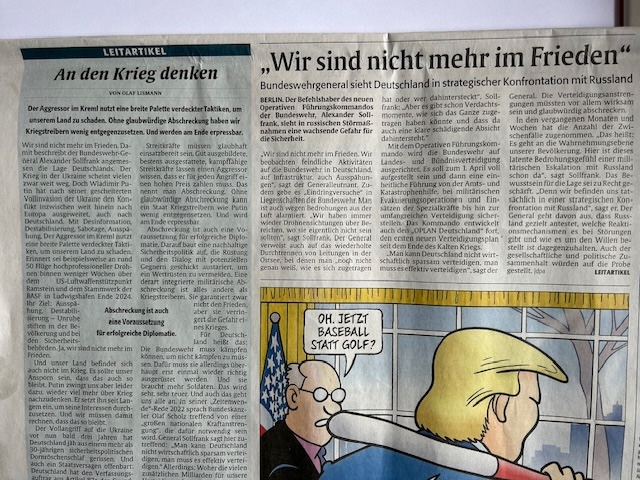








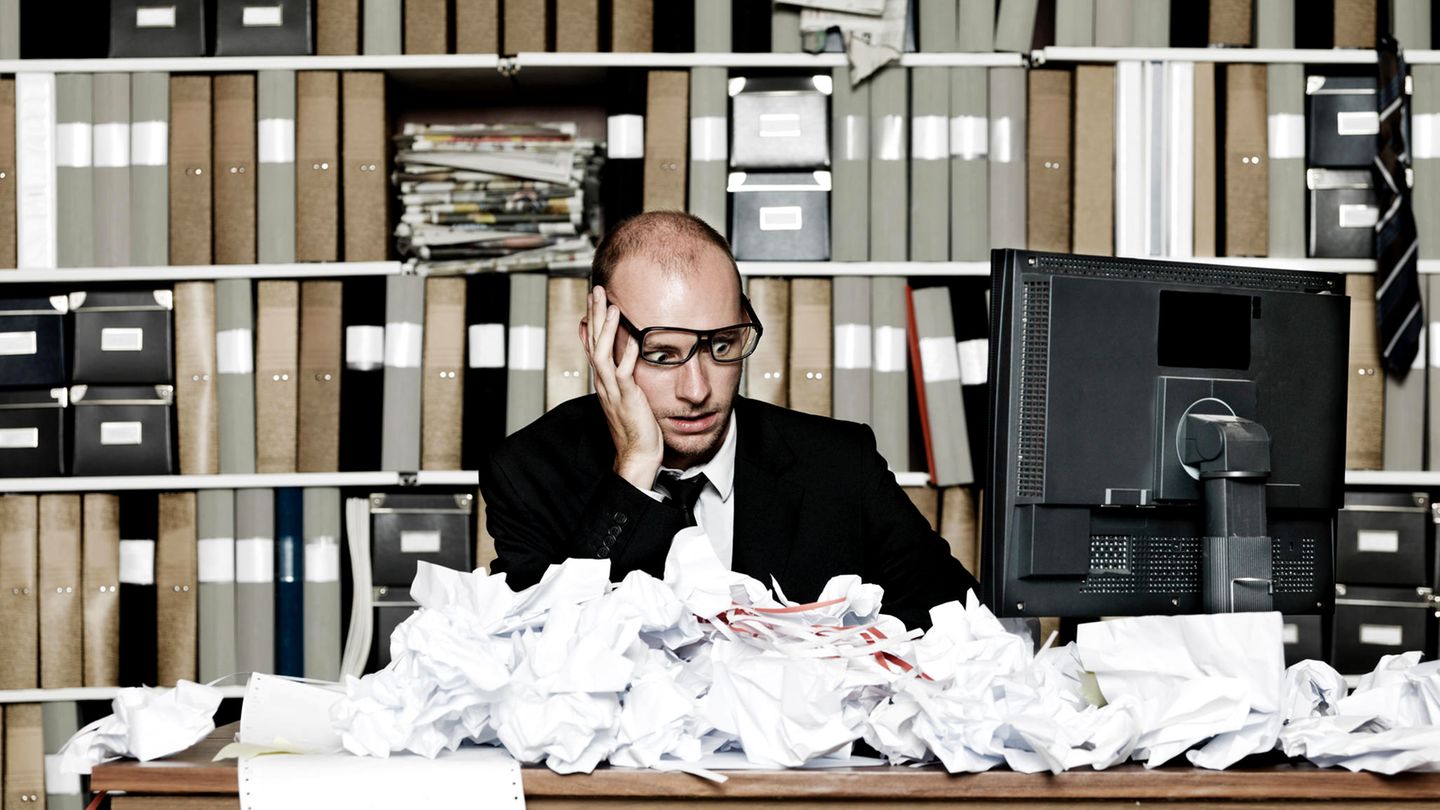


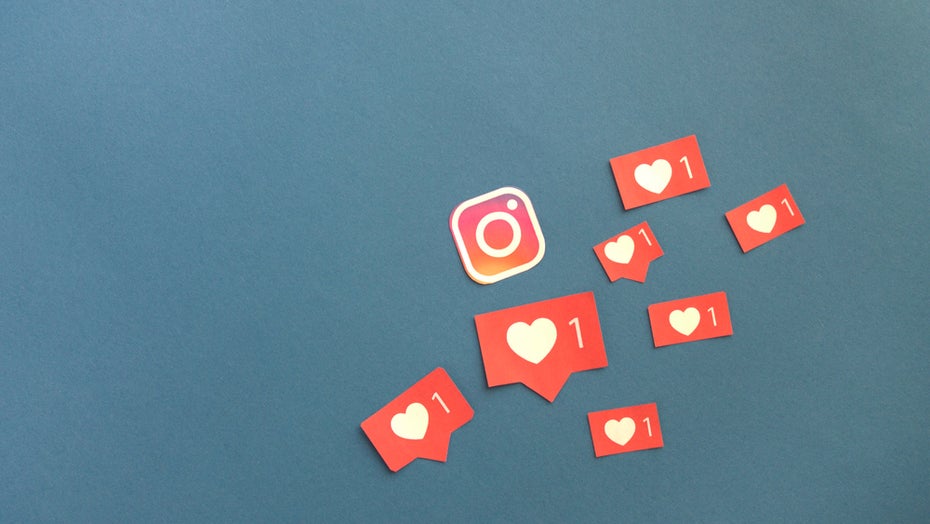

![SEO-Monatsrückblick Januar 2025: Neue Fallstudien, Page Speed + mehr [Search Camp 361]](https://blog.bloofusion.de/wp-content/uploads/2025/02/Search-Camp-Canva-361.png)