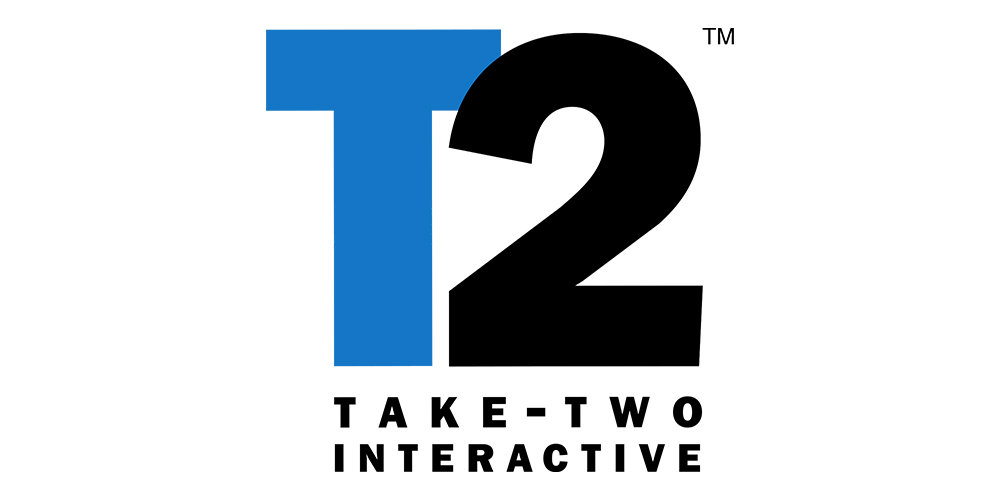Bundestagswahl: Gegen das Erstarken der extremen Parteien hilft nur ein Politikwechsel
Im Wahlkampf wird wieder der Politikwechsel beschworen, doch woher soll er kommen? Eine wie auch immer geartete Koalition aus Parteien der Mitte muss sich nach der Wahl endlich den Themen stellen, die die Menschen bewegen

Im Wahlkampf wird wieder der Politikwechsel beschworen, doch woher soll er kommen? Eine wie auch immer geartete Koalition aus Parteien der Mitte muss sich nach der Wahl endlich den Themen stellen, die die Menschen bewegen
Wenn es nach dem unrühmlichen Ende der Ampelkoalition eine Hoffnung gab, dann die auf klarere Verhältnisse nach einer Neuwahl. Die letzten zwei ihrer insgesamt drei Jahre in der Regierung hatten SPD, FDP und Grüne größtenteils mit Streit und Intrigen verbracht – es musste eine Klärung her. Und das am besten durch eine neue Regierung, die sich wenigstens über ihre wichtigsten Anliegen einigermaßen einig ist. So dürften das sehr viele Menschen im Land vor gut drei Monaten empfunden haben.
Doch wie es aussieht, werden wir diese Klärung mit der Wahl am 23. Februar nicht bekommen. Beide denkbaren Optionen für einen eindeutigen Regierungskurs – eine Koalition aus CDU/CSU und FDP oder ein Bündnis aus SPD und Grünen – sind weit von der Aussicht auf eine Regierungsmehrheit entfernt. Als realistische Koalitionsoption bleibt eine neue „große“ Koalition, die nur noch knapp auf eine Mehrheit der Sitze im Bundestag kommen dürfte. Oder Schwarz-Grün, was noch ein bisschen knapper werden könnte.
Wir können von dieser Wahl also keinen Kurswechsel erwarten, nicht mal eine Klärung oder neue Richtungsbestimmung. Es gibt im Prinzip nur ein Weiter-so – wahrscheinlich mit ein paar Nuancen bei den Themen Klimaschutz und Gesellschaftspolitik. Was die Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik angeht, wäre ein Bündnis aus Union und SPD sogar ziemlich sicher ein Rückschritt, da sich beide Parteien wie in der Vergangenheit auch relativ schnell darauf einigen dürften, bei Rente, Gesundheit, Pflege und beim Bürgergeld den Reformbedarf einfach durch Geld zuzuschütten. Diese Methode vermeidet zumindest weiteren Ärger.
Kaum inhaltliche Schnittmengen zwischen Union und AfD
Diese Aussicht frustriert in diesen Wochen auch viele Wählerinnen und Wähler der politischen Mitte: Ist das jetzt das neue Normal? Werden Regierungskoalitionen künftig nur noch auf der Grundlage des kleinsten gemeinsamen Nenners gegründet? Und wie soll unter diesen Bedingungen überhaupt ein Politikwechsel stattfinden können?
An dieser Stelle wird nun gerne eingewandt, das komme eben heraus, wenn ein Drittel der Stimmen von der Regierungsbildung ausgeschlossen sind: entweder, weil es mit den Parteien für eine Koalitionsmehrheit einfach nicht reicht (FDP); oder weil sie sogar knapp den Einzug in den Bundestag verpassen (eventuell Linke, BSW und FDP); oder weil sie von vornherein als Koalitionspartner tabu sind (AfD). Libertär-konservative Claqueure verweisen in diesem Zusammenhang zwar gern darauf, mit der AfD zusammen hätten CDU und CSU doch eine klare Mehrheit. Wie viel Wirtschaftskompetenz hat Friedrich Merz wirklich?
Das aber mag vielleicht für den Umgang mit kriminellen und ausreisepflichtigen Ausländern im Land gelten, eventuell auch noch für die Frage, ob Deutschland wieder in die Atomenergie investieren sollte. Ansonsten aber gibt es weiterhin kaum inhaltliche Schnittmengen zwischen Union und AfD. In fundamentalen Fragen wie der Zusammenarbeit in Europa, dem Verbleib im Euro, der Unterstützung der Ukraine und der Zukunft der NATO vertritt die AfD vielmehr das glatte Gegenteil von allem, wofür CDU und CSU seit Jahrzehnten einstehen. Das gilt auch nach dem gescheiterten Versuch von Friedrich Merz, notfalls mit den Stimmen der AfD kurzfristig Änderungen in der Asyl- und Migrationspolitik durchzusetzen. Man kann Merz für vieles kritisieren, aber in der Abgrenzung zur AfD bleibt er glasklar – alles andere wäre auch das Ende der Union.
Gleichwohl stimmt der Befund, dass eine Regierungsbildung gegen 30 bis 35 Prozent der abgegebenen Stimmen dauerhaft schwierig ist. Daraus folgt für die Parteien der Mitte aber nicht, dass sie sich künftig mit der extremen Rechten oder extremen Linken auf Koalitionen einlassen sollten. Sondern dass sie endlich die Themen aufgreifen müssen, die die Extremen bedienen und groß machen.
Vermeidungsstrategien funktionieren nicht
Die eigentliche Erkenntnis aus den zurückliegenden drei Monaten ist doch, dass Union, SPD, FDP und Grüne in diesem Wahlkampf lange Zeit über Themen geredet haben, bei denen man sich verwundert fragte, woher diese eigentlich kommen. Das gilt für die verlockend klingenden Steuersenkungsversprechen von CDU und CSU ebenso wie für die diversen Annehmlichkeiten, die SPD, FDP und Grüne gerne verteilen würden. Auch Allerweltsslogans wie „Alles lässt sich ändern“ oder einfach nur „Zuversicht“ wirkten angesichts der ganzen Aufgaben und Probleme im Land ziemlich weltfremd.Wahlprogramme Vergleich
Parteien wie AfD, BSW und Linke halten sich damit nicht lange auf. Ihr Erfolg gründet darauf, Probleme anzusprechen, die viele Menschen wirklich umtreiben: die hohen Energiepreise etwa, die dramatisch steigenden Mieten, überhaupt der leergefegte Wohnungsmarkt und das Gefühl, dauerhaft abgehängt zu sein von den Immobilienpreisen. Hinzu kommen die wirklich schlechte Lage in großen Teilen der deutschen Industrie und die Überforderung vieler Behörden, Gesetze und Regeln noch durchzusetzen, besonders eklatant ausgerechnet in der Asyl- und Migrationspolitik.
Dies sind gar nicht unbedingt immer die größten Probleme des Landes, aber es sind Probleme, die für viele Menschen unmittelbar erkennbar und schmerzhaft sind. Um Lösungen müssen sich die Extremen gar nicht bemühen, oft sind die – ernsthaft angestrebt – auch mühselig und langwierig. Die Parteien der Mitte wiederum scheuen vor diesen Themen zurück, weil sie zuallererst eingestehen müssten, dass sie tatsächlich Fehler gemacht haben, dass sie falsch lagen und Missstände zu lange haben laufen lassen. Was umso schwieriger ist, wenn man die vergangenen 20 bis 30 Jahre selbst immer irgendwo mitregiert hat. Fehler eingestehen, Tabus brechen und mit alten Grundsätzen brechen, das macht niemand gern, erst recht nicht unmittelbar vor einer Wahl.
Doch wenn das Erstarken der extremen Parteien seit der letzten Bundestagswahl eines zeigt, dann, dass Ablenkung und Vermeidungsstrategien nicht funktionieren. Sie machen das Lager der Extremen nur stärker – und echte Politikwechsel nur schwieriger.
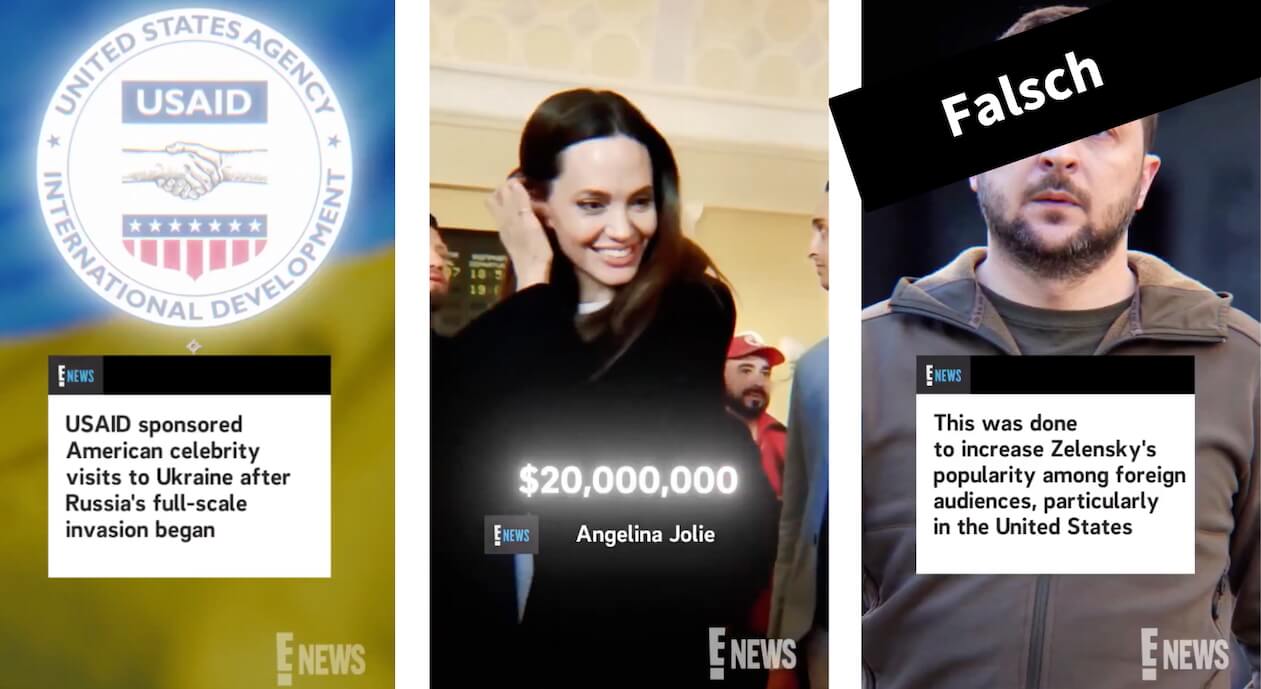














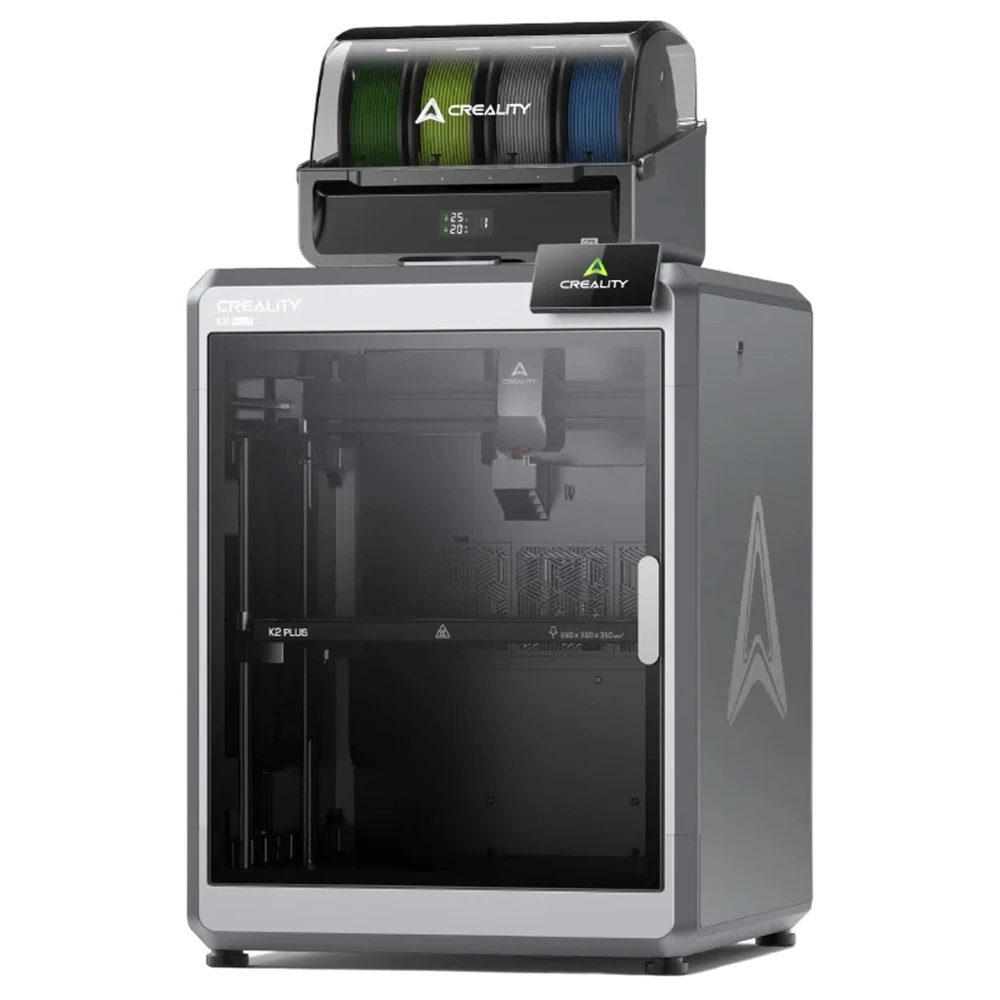






:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/44/22/4422adcbae4d1baad0417b0f20be66ac/0122716715v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/27/3b/273b5907f4b3f556429c6083f68556d5/0122557343v1.jpeg?#)