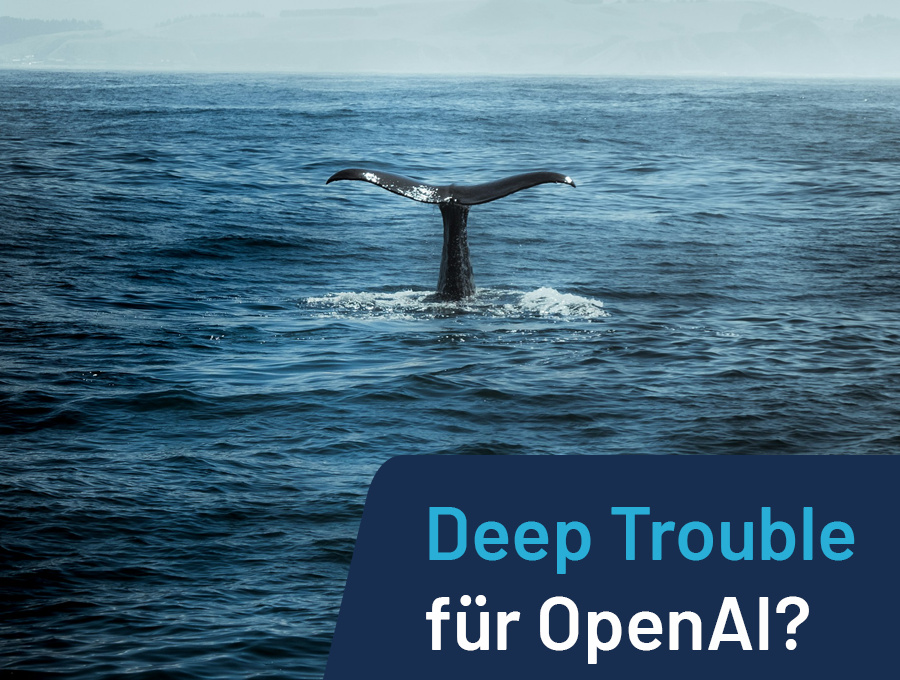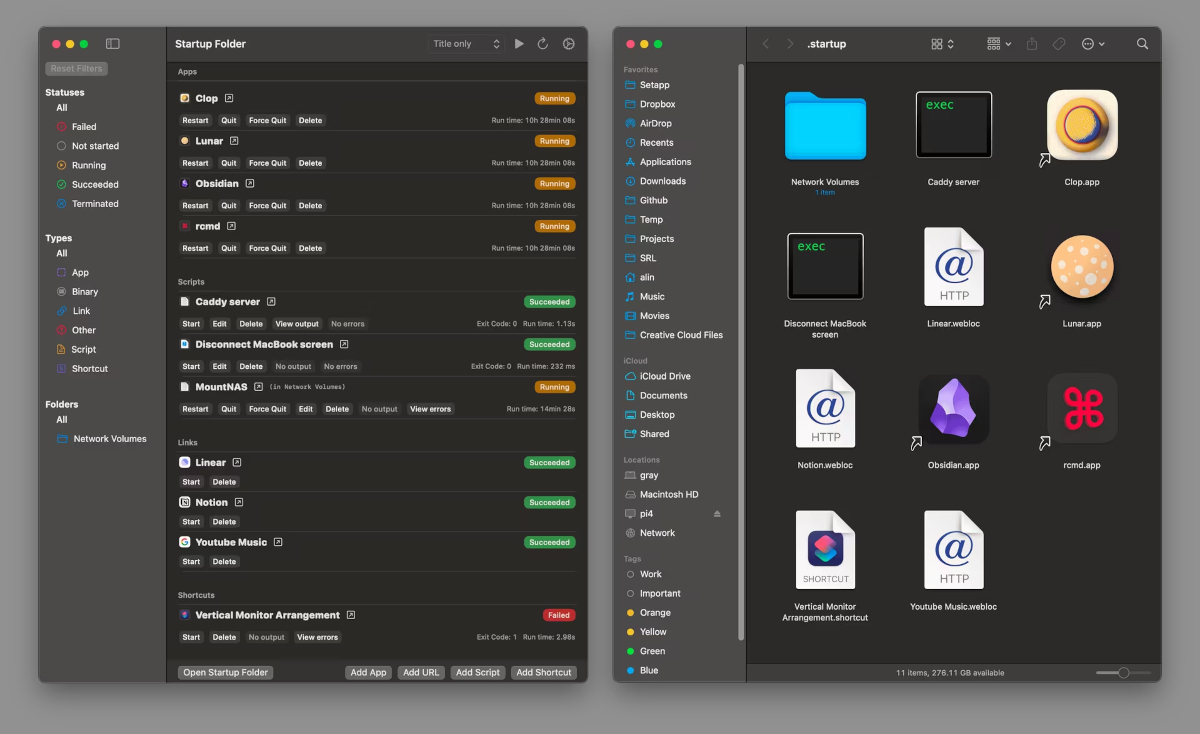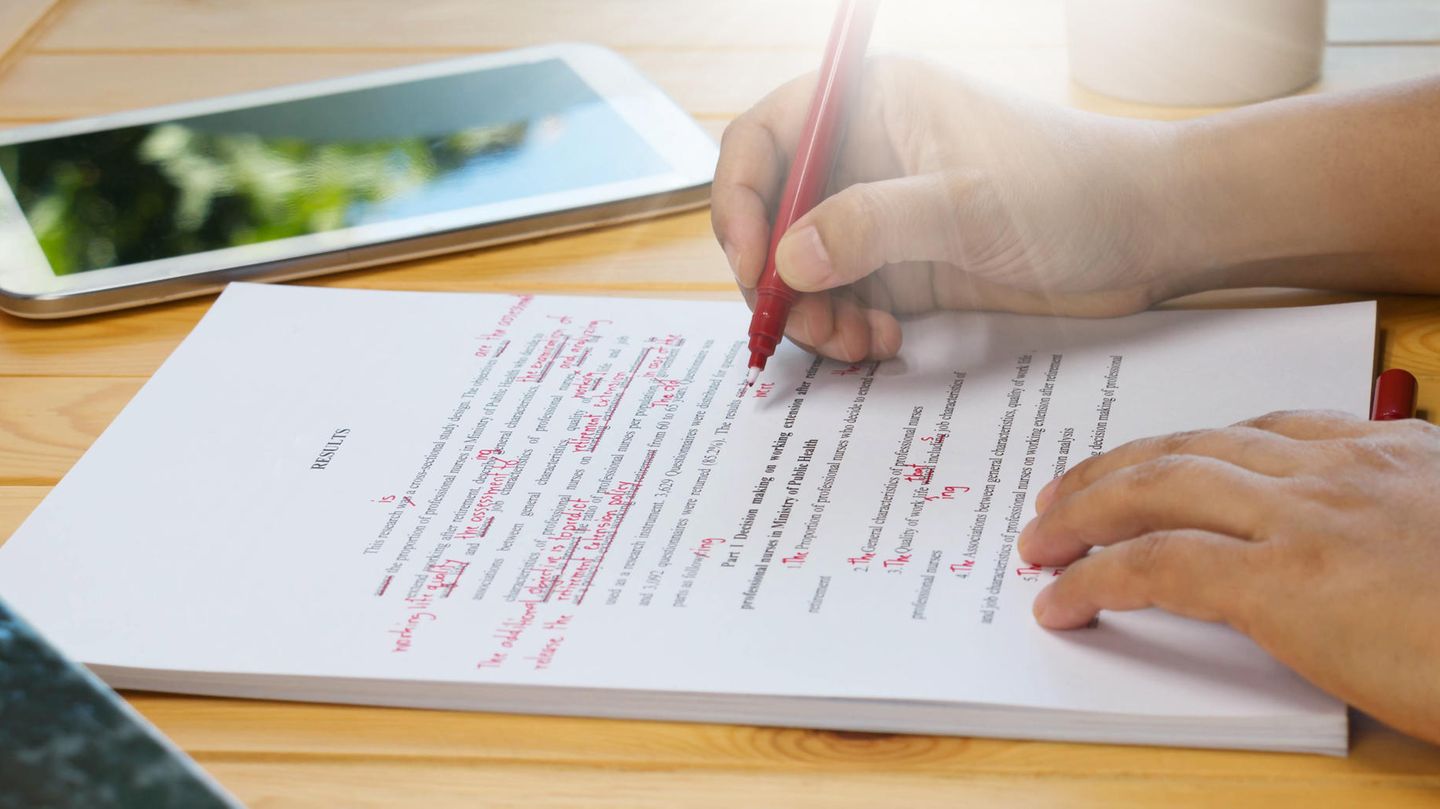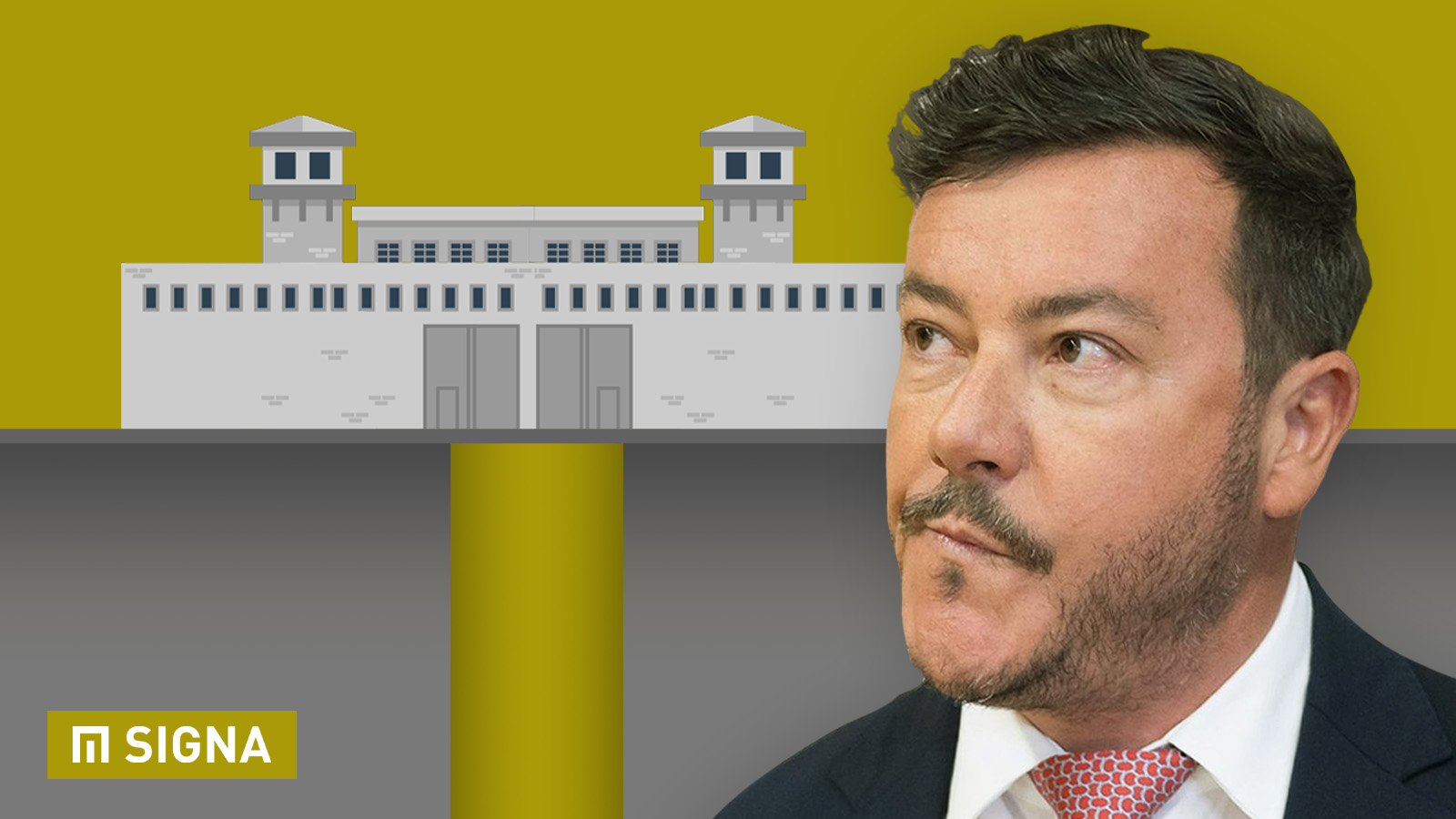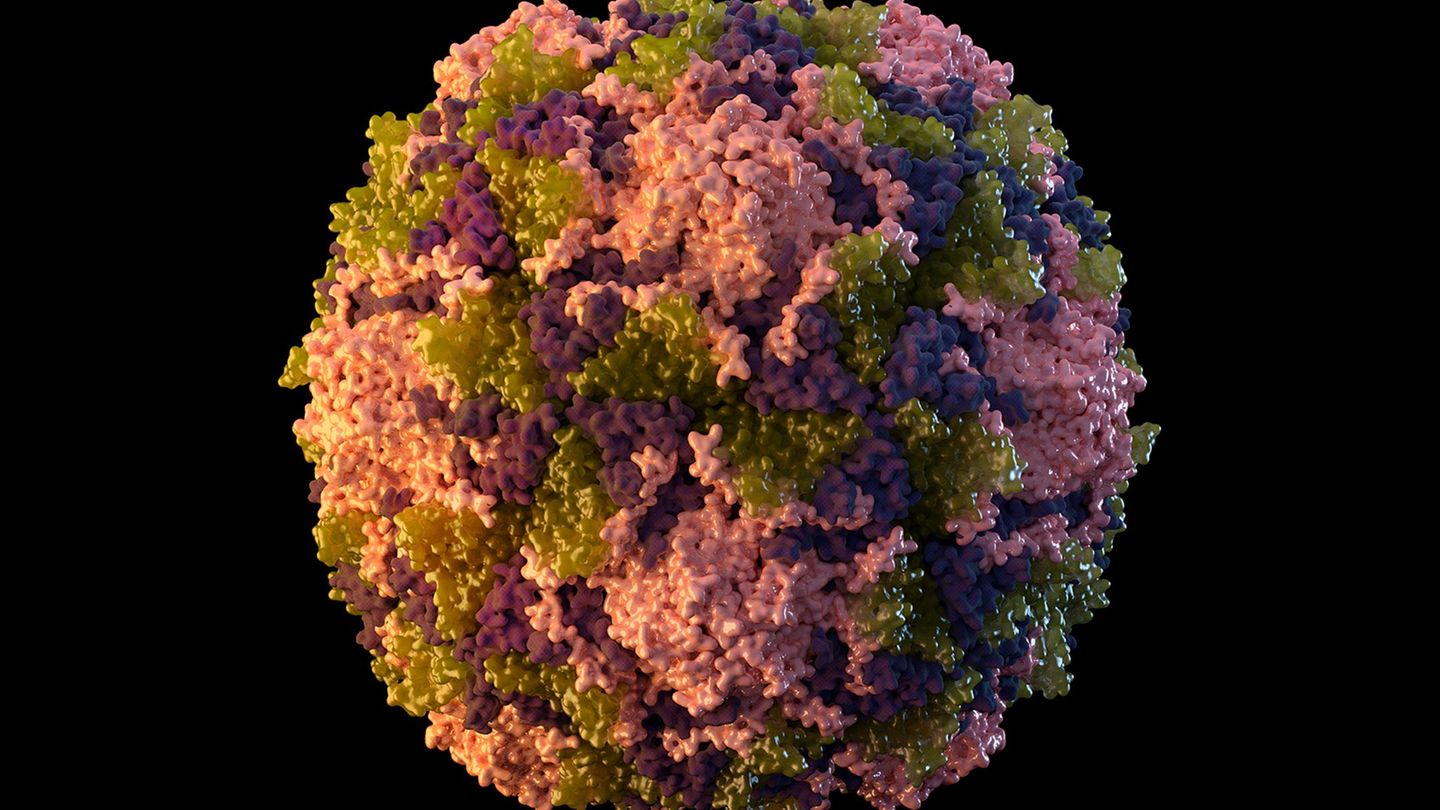Rätsel gelöst: Wie Eisbärenfell eisfrei bleibt und was wir daraus lernen können
Schnee und Wasser gefrieren im menschlichen Haar bei Minusgraden sofort. Anders beim Eisbär. Forschende entdeckten, warum sein Fell eisfrei bleibt – und was wir daraus lernen können

Schnee und Wasser gefrieren im menschlichen Haar bei Minusgraden sofort. Anders beim Eisbär. Forschende entdeckten, warum sein Fell eisfrei bleibt – und was wir daraus lernen können
Fettiges Haar führt bei uns Menschen beim Blick in den Spiegel meist zu Frustration: Schon wieder ein Bad-Hair-Day. Eisbären dagegen macht gerade ihr fettiges Fell zu Spezialisten für das Leben in Schnee und Eis. Lange hatten Forschende gerätselt, wie es die Tiere schaffen, dass ihr dichtes Fell auch bei Minusgraden eisfrei bleibt und sich keine Klumpen von Schnee und Eis darin verfangen – obwohl sich die Tiere im Schnee wälzen und als einzige arktische Landsäuger bei der Jagd auch ins eisige Wasser tauchen. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam das Anti-Eis-Geheimnis des Eisbären (Ursus maritimus) gelüftet: Sein fettiges und dichtes Fell hält ihn nicht nur bei Temperaturen von bis zu minus 45 Grad Celsius warm. Der besondere Talg, der die Haare ummantelt, sorgt auch dafür, dass kein Eis daran haften und gefrieren kann.
Die Forschenden, die ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift "Science Advances" veröffentlichten, untersuchten die Haare von sechs in freier Wildbahn lebenden Bären und verglichen sie mit menschlichem Haar, in dem Schnee und Wasser bei Minusgraden schnell gefrieren – unabhängig davon, ob es frisch gewaschen oder fettig ist. Wurden die Eisbärenhaare gründlich gewaschen und von ihrer natürlichen Fettschicht befreit, verhielten sie sich ähnlich wie menschliches Haar: Eis verfing sich darin viermal so stark wie in den ungewaschenen Haaren und ließ sich nur mit Mühe wieder entfernen.
"Der Talg erwies sich schnell als Schlüsselkomponente für diesen Anti-Eis-Effekt, da wir feststellten, dass die Haftung durch das Waschen der Haare stark beeinträchtigt wurde", sagt Studienautor Julian Carolan, Doktorand am Trinity College Dublin, in einer Mitteilung der Universität. "Ungewaschenes, fettiges Haar erschwerte das Anhaften von Eis."
GEO2207 Der Bärgermeister aus Kanada_LT
Die Forschenden untersuchten deshalb den Talg auf den Bärenhaaren genauer und entdeckten darin Cholesterin, Diacylglycerin und Fettsäuren. Interessant ist aber vor allem, was der Talg nicht enthielt: Squalen. Dieses Fettstoffwechselprodukt kommt im Talg menschlicher Haare vor, aber auch im Fell von Wassertieren wie dem Biber oder dem Seeotter. Berechnungen zeigten, dass Squalen stärker an Eis bindet als die anderen im Talg enthaltenen Substanzen. Sein Fehlen im Eisbärentalg, schließen die Forschenden, ist damit für das eisfreie Fell der Bären verantwortlich.
Inspiration für die Beschichtung von Outdoorkleidung
Diese Erkenntnis könnte sich auch der Mensch zunutze machen: Ein ähnlich wie Bärentalg zusammengesetzter künstlich hergestellter Talg könnte als alternative Oberflächenbeschichtung von Outdoorkleidung oder als Anti-Eis-Beschichtung von Skiern eingesetzt werden. Diese sind bislang häufig mit PFAS ummantelt, per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, die zwar wasser- und schmutzabweisend, aber auch toxisch sind. Sie reichern sich in der Nahrungskette an, können sich in Luft und Wasser absetzen und lassen sich unter normalen Umweltbedingungen praktisch nicht abbauen – und werden daher auch als Ewigkeitschemikalien bezeichnet. Die Forschenden gehen davon aus, dass die Lipidbeschichtung des Bären dabei helfen kann, neue nachhaltigere Anti-Icing-Beschichtungen zu entwickeln, die die gesundheits- und umweltschädlichen Ewigkeitschemikalien ersetzen können.
Auch das Jagdverhalten der Eisbären ist durch die neuen Erkenntnisse besser zu verstehen: "Eine der wichtigsten Strategien der Eisbären ist die 'stille Jagd', bei der sie regungslos neben einem Atemloch auf dem Meereis liegen und darauf warten, dass Robben auftauchen", sagt die ebenfalls an der Studie beteiligte Experimentalphysikerin Bodil Hols von der Universität Bergen. "Die stille Jagd geht oft in eine Wasserpirsch über, bei der der Eisbär mit seinen Hinterpfoten ins Wasser gleitet, um seine Beute zu verfolgen. Je geringer die Eishaftung ist, desto weniger Lärm erzeugt er und desto schneller und leiser gleitet er."
So perfekt der Eisbär an ein Leben in Schnee und Eis angepasst ist, so sehr machen ihm Klimawandel und Eisschmelze zu schaffen: Zwischen den Höckern an den Tatzenballen, die dem Bären perfekten Halt auf glattem Eis geben, verfangen sich neuerdings Klumpen von Schnee, der durch den Klimawandel und den damit zunehmenden Regen feucht und matschig wird – und dann zwischen den Tatzen der Bären wieder gefriert. Forschende beobachteten deshalb zuletzt Eisbären mit Eisablagerungen, Geschwüren, und tiefen Riss- und Schnittwunden an den Tatzen, die die Fortbewegung der Tiere mindestens schmerzhaft oder aber praktisch unmöglich machen.