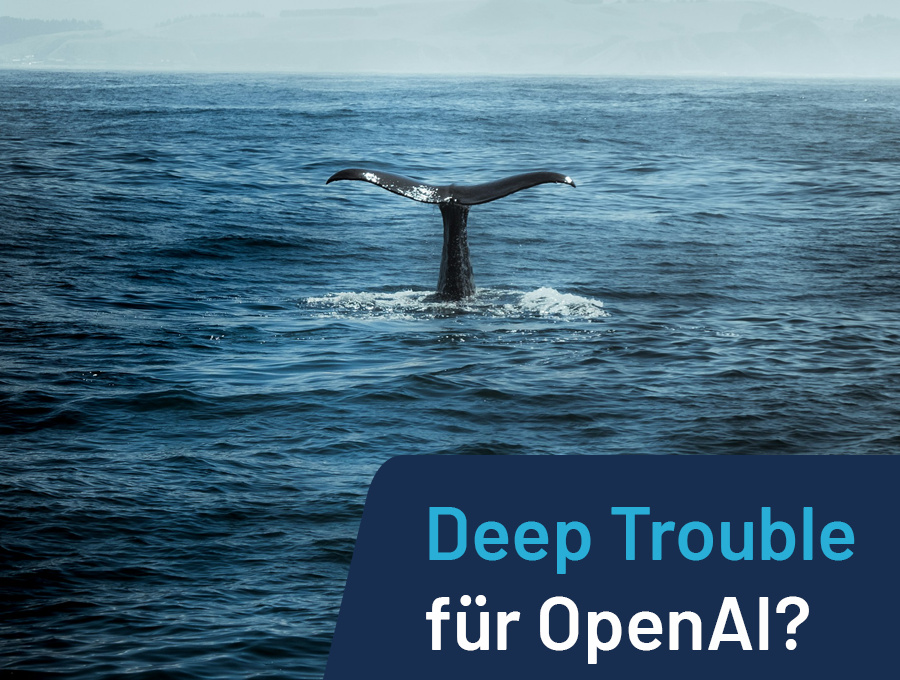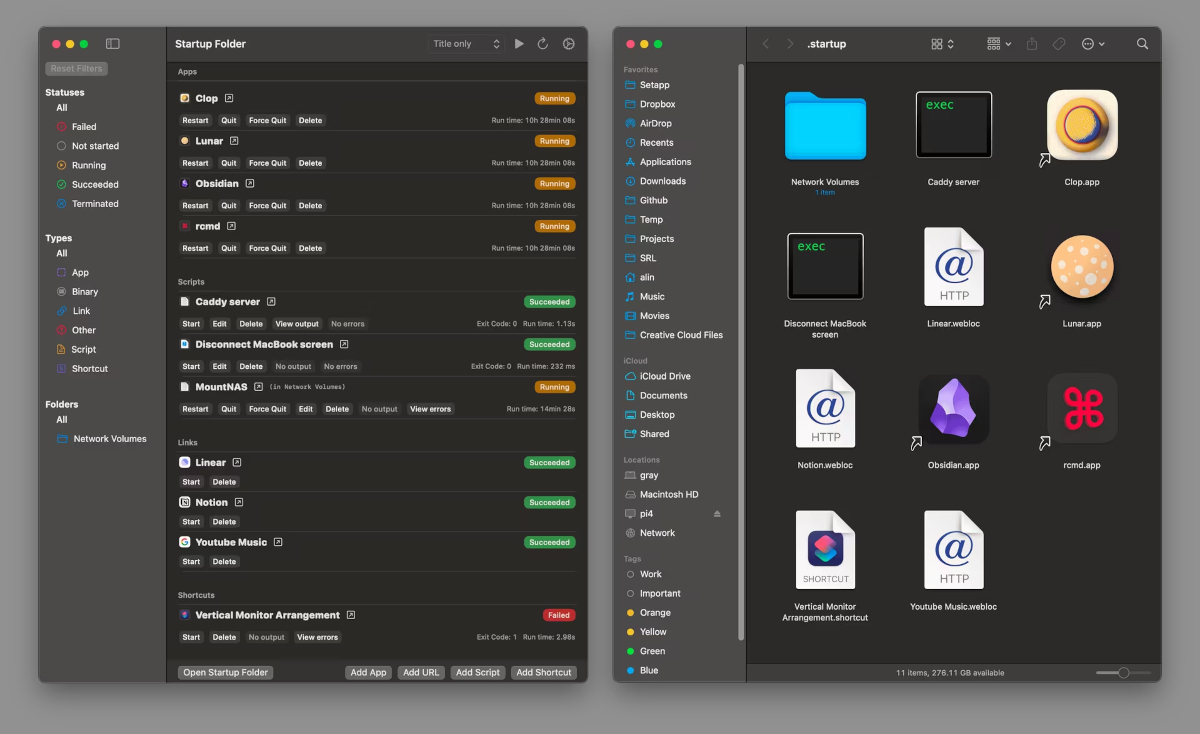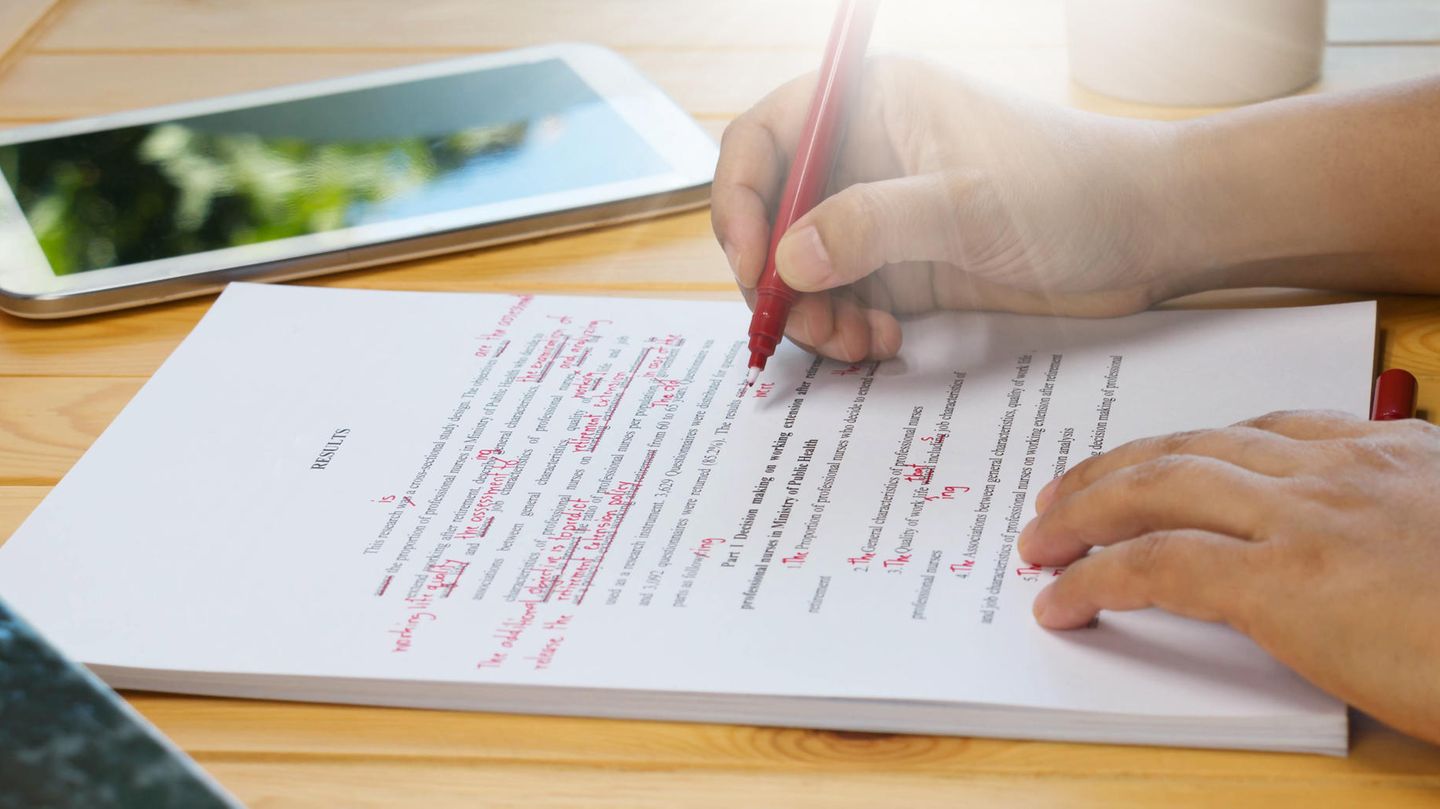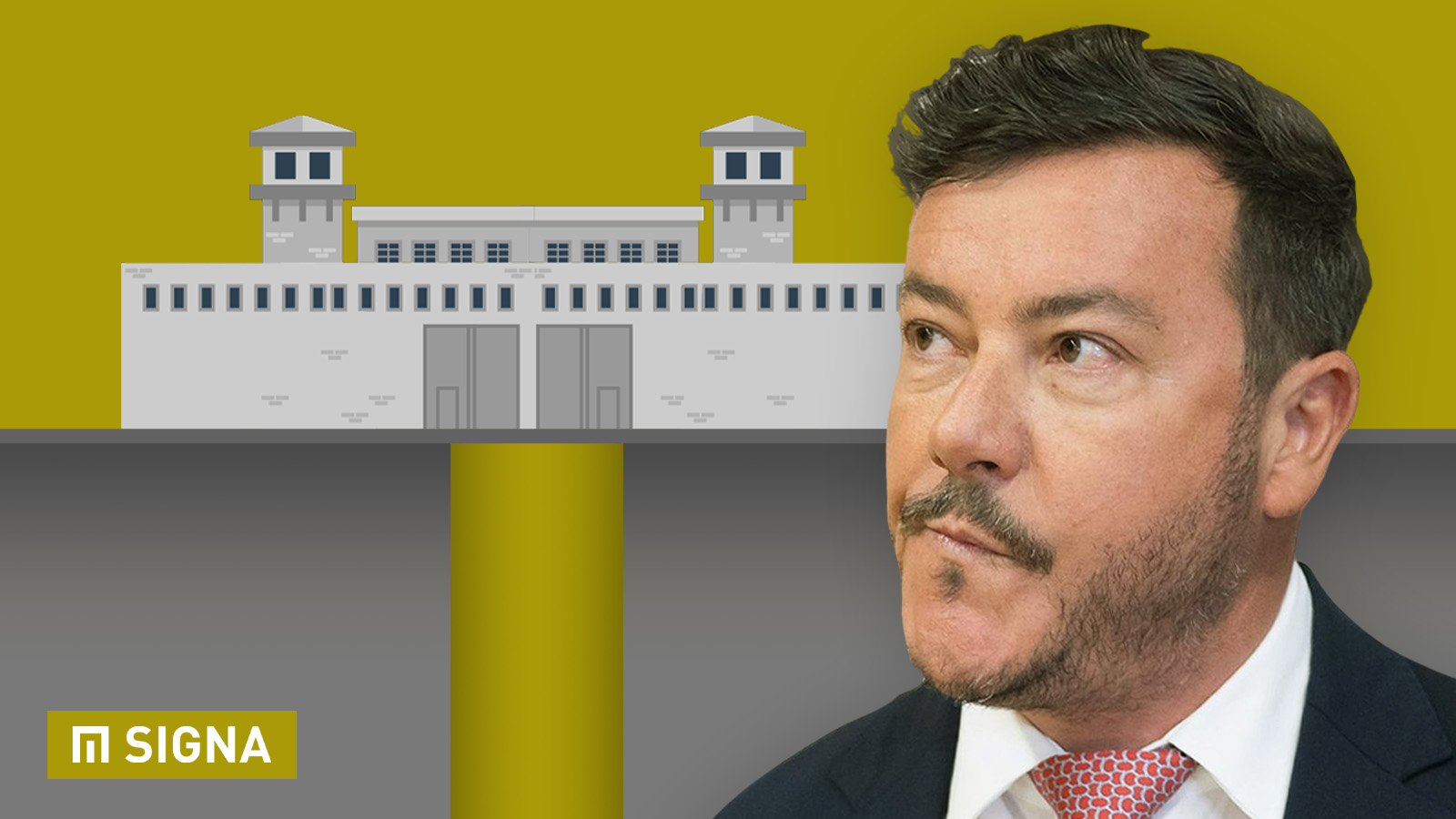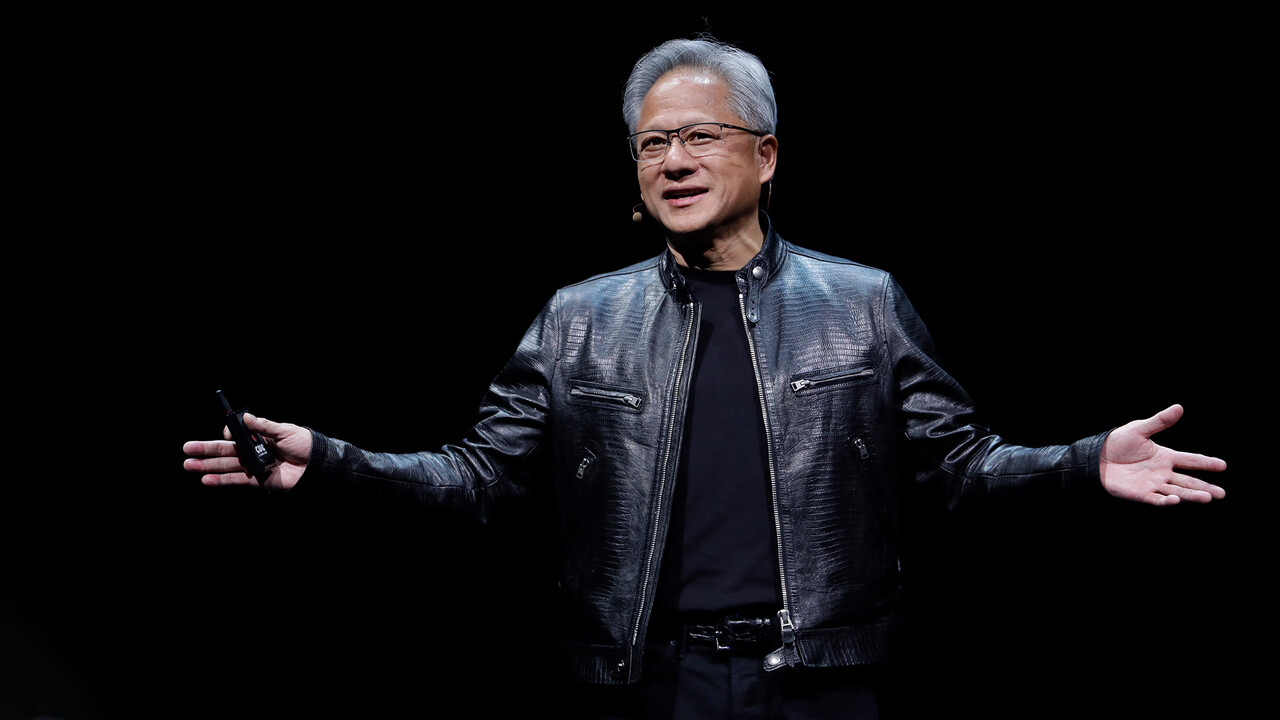Bundestagsabstimmung: Das Merz-Debakel: Fünf Lehren aus dieser Woche für den Wahlkampf
Friedrich Merz hat sich völlig unnötig in eine Sackgasse manövriert. In der strittigen Frage der Migrationspolitik ist Deutschland keinen Millimeter vorangekommen – im Gegenteil

Friedrich Merz hat sich völlig unnötig in eine Sackgasse manövriert. In der strittigen Frage der Migrationspolitik ist Deutschland keinen Millimeter vorangekommen – im Gegenteil
Nach den Erfahrungen der vergangenen acht Wochen sollte man mit Prognosen in diesem Wahlkampf vorsichtig sein. Zu oft schon wurde das Ende der FDP ausgerufen, zu oft die große Blamage des grünen Spitzenkandidaten oder die finale Demontage des Noch-Kanzlers. Merkwürdigerweise aber machen alle einfach weiter und merkwürdigerweise stürzt bisher nirgendwo irgendjemand in den Umfragen ab. Eher wirken die Parteien und ihre Spitzenkandidaten in den üblichen Rankings vor der Wahl wie einbetoniert.
Das gilt wahrscheinlich auch nach dieser Woche, von der viele sagen, es sei die entscheidende gewesen. Mag sein. Aber was zu wessen Gunsten in dieser Woche wirklich entschieden wurde, ist doch weiter ziemlich unklar.
Zweimal stellten die Abgeordneten von CDU und CSU unter Führung ihres Kanzlerkandidaten Friedrich Merz im Bundestag ihre Vorstellungen zur Migrations- und Asylpolitik zur Abstimmung – gegen den erklärten Willen von SPD und Grünen und im Wissen, dass sie eine Mehrheit wahrscheinlich nur mit den Stimmen der AfD bekommen würden. Damit brach Merz eine Zusage, die er erst vor wenigen Wochen nach dem Ende der Ampel-Koalition gegeben hatte.
Was nun vielfach als Tabubruch beschrien wird, wirkt umso absurder, als es die großen strittigen Fragen in der Migrationspolitik keinen Millimeter voranbringt – im Gegenteil sogar. Das gilt sowohl für den am Mittwoch mit den Stimmen der AfD beschlossenen Entschließungsantrag als auch für den heute gescheiterten Entwurf eines “Zustrombegrenzungsgesetzes”. Letzteres wäre selbst mit Mehrheit heute nicht durch den Bundesrat gekommen, ersterer müsste ja erst von einer neuen Regierungskoalition nach der Wahl in ein Gesetz gegossen werden. Beides dürfte für Merz nun nicht gerade einfacher geworden sein.
Umso mehr stellt sich die Frage: Was überhaupt lehrt diese Woche? Fünf Erkenntnisse drängen sich auf:
1 Merkels Rüffel schadet Merz – auch wenn er eingepreist war
Friedrich Merz kämpft in den verbleibenden drei Wochen dieses Wahlkampfs nicht mehr nur um die Stimmen all derer, die keine feste politische Heimat haben (was Spitzenkandidaten normalerweise tun) – sondern auch um einen Gutteil seiner hauseigenen CDU-Stimmen. Auch wenn er seine Abgeordneten in der Bundestagsfraktion ziemlich geschlossen hinter sich hat, gilt das nicht für die gesamte CDU. Und erst Recht nicht mehr nach dem Theater der letzten 48 Stunden.
Im Merz-Lager galt Ex-Kanzlerin Angela Merkel schon seit Jahren als Grund allen Übels im Land (aka Stillstand, Reformstau und wirtschaftlicher Niedergang) sowie als Hauptschuldige für den Aufstieg der AfD – ein Befund, der in Teilen durchaus berechtigt ist. Doch bemühte sich Merz zurecht, diesen Bruch mit seiner Vor-Vor-Vorgängerin nicht allzu offensichtlich erscheinen zu lassen. Denn er weiß, dass er für ein Ergebnis oberhalb der 30 Prozent auch die eher liberalen CDU-Wähler in den westdeutschen Großstädten braucht. Merkels öffentlicher Rüffel – so absehbar und naheliegend er für alle Merkel-Kenner und wohl auch für Merz selbst war – ist für ihn daher doch eine schwere Belastung.
2 Auch SPD und Grüne profitieren nicht
Außer zur Schau gestellter Empörung haben SPD und Grüne in dieser Woche wenig beigetragen. Sie mögen darauf pochen, dass Parteien der Mitte keine Mehrheiten mit radikalen Kräften suchen sollten – ein Etikett, das Merz selbst mit Bezeichnungen wie „denen da“ für die AfD immer wieder erneuert. Doch sie müssen sich auch fragen lassen, was denn nun ihr Beitrag zur Lösung der Migrationsprobleme im Land ist.
Man kann vielleicht zu der Einschätzung gelangen, dass es, abgesehen von Einzelfällen, in der Migrations- und Asylpolitik keine systemischen Probleme gebe – oder wenn es welche gibt, lägen die Lösungen anderswo als dort, wo sie die Union im Moment sucht. Dies ist die Position des Noch-Kanzlers und seiner Innenministerin. Allerdings ist der bissige Hinweis von Merz ja richtig, dass selbst weite Teile der SPD-Wählerschaft in bestimmten Regionen inzwischen ins Lager der AfD übergelaufen sind. Die SPD verfolgt in diesem Politikfeld eine Linie, mit der sie bei ihrer eigenen Basis in Essen, Duisburg und Kassel kaum noch ankommt. Sie kann so weitermachen, aber von nennenswerten Wahlerfolgen entfernt sie sich so immer mehr.
3 Merz' Vorschlag war kurzsichtig
Man muss Merz nicht die Absicht unterstellen, sich entgegen seiner Beteuerungen nach der Wahl doch noch mit den Stimmen der AfD zum Kanzler wählen zu lassen. In seiner Abgrenzung zum Gedankengut und zur sonstigen Programmatik der AfD ist Merz sehr klar. Er will Kanzler werden, aber er will sicher nicht in die Geschichtsbücher eingehen als erster Kanzler, der sich mit den Stimmen einer in weiten Teilen rechtsradikalen Partei ins Amt wählen ließ.
Wie Jimmy Hoffa mit Mafia-Deals zum Mythos wurde
Umso mehr stellt sich jedoch für Merz die Frage, mit wem er nach dem 23. Februar eine Regierungskoalition bilden will. Seine Festlegung, keine Kompromisse mehr in der Flüchtlingspolitik machen zu wollen, ist kurzsichtig und tollkühn – sie wird ihm noch sehr im Weg stehen. Dies ist umso tragischer, als es bei dieser vorgezogenen Bundestagswahl eigentlich darum ging, endlich wieder eine stabile Regierung zu bilden, die die Probleme des Landes angeht. Und davon gibt es weit mehr als nur die Flüchtlings- und Asylpolitik: fehlendes Wachstum, eine unterfinanzierte Verteidigung, überfrachtete Sozialsysteme, zu wenig öffentliche Investitionen, um nur einige zu nennen. Statt immer mehr Zuspitzung und Polarisierung brauchen wir hier endlich tragfähige Kompromisse mit den Mehrheiten, die da sind.
4 Der große Gewinner heißt AfD
Der große Gewinner dieser Woche ist ausgerechnet die Partei, die alle anderen bekämpfen wollen: die AfD. Dass die Union in den kommenden Wochen enttäuschte konservative Wähler zurückgewinnen kann, ist unwahrscheinlich. Denn zu überzeugend ist das Gegenargument der AfD, dass die Union ohne eine starke AfD nach der Wahl wieder anderswo die Mehrheiten suchen wird. Wer also wirklich sichergehen will, dass nach der Wahl auch umgesetzt wird, was diese Woche an Anträgen und Gesetzentwürfen von der Union eingebracht wurde, so wird die AfD argumentieren, muss eben das Original starkmachen. Merz’ Beteuerung, er wolle mit „denen da“ nichts zu tun haben, ist zwar persönlich glaubwürdig, kann aber an den Wahlergebnissen scheitern – direkt hinter der bayerischen Grenze in Österreich lässt sich nun täglich beobachten, wie lange solche Zusagen gelten können, wenn die politischen Konstellationen nichts anderes mehr hergeben.
5 Merz ist der Verlierer der Woche
Der große Verlierer dieser Woche ist daher Friedrich Merz selbst. Dass er noch ein oder zwei Prozentpunkte von der AfD gewinnen könnte, glaubt er nach dem Debakel an diesem Freitag im Bundestag wahrscheinlich selbst nicht mehr. Aber entscheidender wird sein, was nach der Wahl aus der neuerlichen Zuspitzung folgt. Und das wird nichts Gutes sein. Etwas Richtiges mag zwar richtig bleiben, auch wenn die Falschen zustimmen, wie er vor den Abstimmungen zu seinem Antrag und Gesetzentwurf immer wieder selbstbewusst doziert hat – aber es kann sich doch als schwerer Fehler erweisen.
Selbst seine größten Kritiker und Skeptiker in der eigenen Partei – und von denen gab es immer sehr viele – gestanden ihm große Talente zu: Schnell sei Merz, analytisch scharf, außerdem ein guter Redner. Aber er sei eben auch impulsiv, ihm fehle das Korrektiv, das ihn bremst, wenn es nötig ist. Genau das hat man in dieser Woche gesehen. Ich empfehle Ihnen als Wochenendlektüre unbedingt die spannende Rekonstruktion meiner stern-Kollegen Julius Betschka und Veit Medick, die nachgezeichnet haben, wie sich Merz in diese verfahrene Lage hineinmanövrierte – wirklich sehr lesenswert. Zu Merz’ zweifelhafteren Talenten zählt offensichtlich die Gabe, binnen weniger Stunden einreißen zu können, was er zuvor über viele Wochen und Monate mühsam aufgebaut hat. Für das Amt des Bundeskanzlers ist das einfach ein Problem.